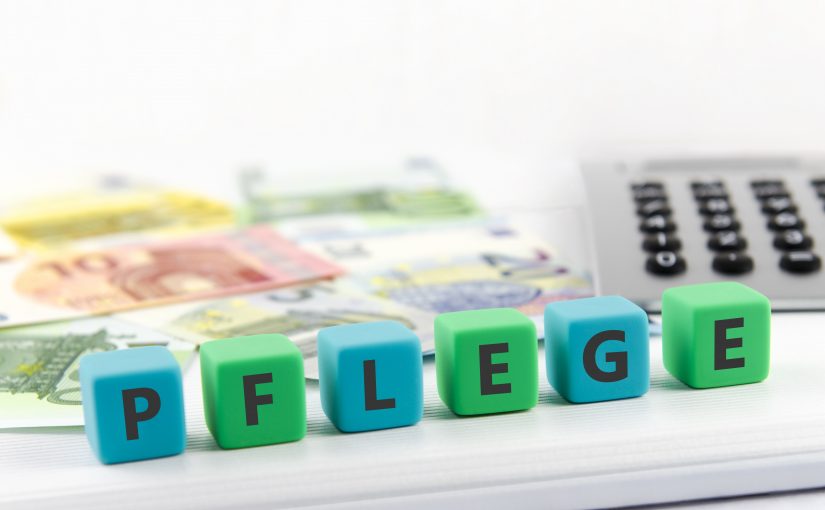Am 16. März 2023 wird der Bundestag über die Einführung und Ausgestaltung des „Deutschlandtickets“ (49 Euro – Ticket) entscheiden. Es war im letzten Jahr als Teil der Entlastungspakete angekündigt worden. Nach monatelanger Debatte um die Ausgestaltung liegt nun der entscheidende Gesetzentwurf dem Bundestag zur Abstimmung vor.
Finanzierung
Wie schon beim dreimonatigen 9 Euro-Ticket letzten Sommer, erfordert das Deutschlandticket eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes, weil es um die Aufteilung der Finanzierung zwischen Bund und Ländern geht. Deswegen muss auch der Bundesrat dem Gesetz noch zustimmen, dem ein gleichlautender Gesetzentwurf schon vorliegt. Die Einbringung von wortgleichen Gesetzentwürfen durch die Bundesregierung in die Beratungen des Bundesrates und der Koalitionsfraktionen in die Beratungen des Bundestages wird bei eilbedürftigen Gesetzesvorhaben angewendet, um eine parallele Beratung und somit ein schnelleres Gesetzgebungsverfahren zu ermöglichen. Für die Abstimmung werden eine Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses sowie ein Bericht des Haushaltsausschusses zur Finanzierbarkeit erwartet.
1,5 Milliarden jährlich vom Bund
Der Bund soll die Bundesländer von 2023 bis 2025 mit 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Finanzierung des sogenannten Deutschlandtickets im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterstützen.
ausschließlich digital
Das Deutschlandticket soll gemäß der Einigung zwischen der Bundesregierung Länderregierungen vom 2. November vergangenen Jahres zum Einführungspreis von 49 Euro zur Benutzung des ÖPNV im gesamten Bundesgebiet berechtigen. Es soll ausschließlich in einer digitalen Form und in einem monatlich kündbaren Abonnement verkauft werden.
ab 1. Mai
Da das Deutschlandticket nicht wie ursprünglich geplant zum 1. Januar eingeführt werden konnte, soll die Erhöhung der Regionalisierungsmittel in diesem Jahr in Form einer Abschlagszahlung an die Länder vorgenommen werden, um Mindereinnahmen der Verkehrsbetriebe auszugleichen. Die tatsächlichen Mindereinnahmen in diesem Jahr sollen 2024 ermittelt werden.
Um die Finanzierung des bundesweit gültigen Nahverkehrstickets dauerhaft zu sichern, soll auf Grundlage einer Auswertung der verkehrlichen und finanziellen Auswirkungen des Deutschlandtickets 2025 ein erneutes Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden. Das Deutschlandticket soll nach aktuellem Stand zum 1. Mai 2023 eingeführt werden.
Preissteigerungen wahrscheinlich
Der offizielle Name „Deutschlandticket“ ist natürlich deswegen so gewählt, weil eine Preissteigerung in den nächsten Jahren wahrscheinlich ist und eine Umbenennnung nach vielleicht einem Jahr in „52-“ oder „54-Euro-Ticket“ nicht viel Sinn macht.
Was möglich gewesen wäre…
Mit hoher Wahrscheinlichkeit abgelehnt werden dagegen Anträge der Linksfraktion, die aber deutlich machen, was man bei gutem Willen auch aus dem Deutschlandticket hätte machen können:
365-Euro-Ticket
Zum einen fordern sie die Einführung eines 365-Euro-Ticket pro Jahr (20/2575). Der vergünstigte Preis des 365-Euro-Tickets soll umgerechnet auch für Tages- und Wochenkarten gelten. Zudem sollen Menschen ohne eigenes oder mit geringem Einkommen, zum Beispiel Schüler, Auszubildende und Hartz-IV-Empfänger, den ÖPNV kostenlos benutzen dürfen.
Null-Euro-Ticket
Die Fraktion Die Linke fordert außerdem ein Null-Euro-Ticket für Studierende, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler sowie Absolventinnen und Absolventen eines Freiwilligendienstes. (20/5785). Ein Nulltarif ÖPNV würde die knappen finanziellen Ressourcen entlasten und allen Schülerinnen und Schülern sowie den Auszubildenden und Studierenden mehr Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen. Die notwendigen Kosten für den Weg zu Bildungs- und Arbeitsstätten entfielen, Kultur-, Sport- und Freizeitstätten könnten selbstständig aufgesucht werden und der ÖPNV werde in der alltäglichen Nutzung attraktiver. Ein Null-Euro-Ticket würde zu mehr Chancengleichheit und zum Klimaschutz beitragen.
Quellen: Bundestag, Fraktion Die Linke, Fokus-Sozialrecht
Abbildung: Fotolia_130138477_Subscription_XL.jpg