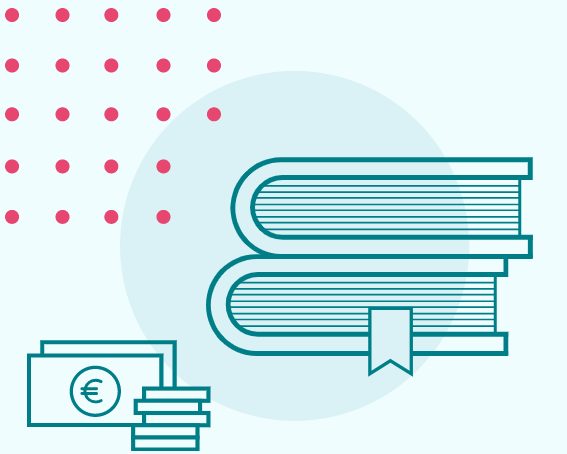Die Regelungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) über die Höhe der Ausbildungsförderung für Studierende im Jahr 2021 verstoßen gegen das Grundgesetz. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden. Da das Verwaltungsgericht als Fachgericht nicht befugt ist, die Verfassungswidrigkeit eines Parlamentsgesetzes selbst festzustellen, hat die 18. Kammer das Verfahren ausgesetzt und die Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.
BAFöG-Änderungsgesetz tritt in Kraft
Diese Entscheidung des VG Berlin kommt genau in dem Moment, als das 29. BAFöG-Änderungsgesetz verabschiedet wurde und die neuen Zahlen an die Öffentlichkeit kommen. Der neue Bedarfssatz ist mit 475 Euro um 88 Euro niedriger als das Bürgergeld (563 Euro). In dem Fall, dass das VG Berlin entschieden hat, ging es um eine Differenz von 19 Euro aus dem Jahren 2021/2022.
Ähnliches vom Bundesverwaltungsgericht
Das Bundesverwaltungsgericht legte im Mai 2021 dem Bundesverfassungsgericht einen ähnlichen Streitfall vor, weil es die Höhe der Ausbildungsförderung für Studierende im Jahr 2014 für verfassungswidrig hielt.
Auch Unterkunftsbedarfssatz zu niedrig
Im jetzigen Beschluss hält das Verwaltungsgericht nicht nur den Bedarfssatz für zu niedrig, niedriger jedenfalls als das Existenzminimum, dass ja das Bürgergeld abbilden soll. Auch die Höhe des Unterkunftsbedarfs sei evident zu niedrig gewesen, weil im Sommersemester 2021 bereits 53 Prozent der Studierenden monatliche Mietausgaben von 351 Euro aufwärts gehabt hätten, dabei knapp 20 Prozent zwischen 400 und 500 Euro sowie weitere rund 20 Prozent mehr als 500 Euro. Zudem könne als Vergleichsmaßstab nicht ein Gesamtdurchschnitt der Unterkunftskosten im gesamten Bundesgebiet genommen werden, sondern nur ein Durchschnittswert der Unterkunftskosten am Studienort der studierenden Person oder jedenfalls an vergleichbaren Studienorten.
Pauschalierungsbefugnis hat verfassungsrechtliche Grenzen
Die Pauschalierungsbefugnis des Gesetzgebers finde bei der Gewährleistung des existenziellen und ausbildungsbezogenen Unterkunftsbedarfs von Studierenden jedenfalls dann eine verfassungsrechtliche Grenze, wenn – wie 2021 – die durchschnittlichen Unterkunftskosten Studierender im Vergleich der Bundesländer bis zu 140 Euro differieren (von 456 Euro in Hamburg bis 317 Euro in Thüringen), im Vergleich der einzelnen Hochschulorte sogar bis zu 230 Euro (von 495 Euro in München bis 266 Euro in Freiberg/Sachsen).
Methodische Fehler
Außerdem beruhe die Festlegung der Bedarfssätze auf verschiedenen schwerwiegenden methodischen Fehlern. So habe der Gesetzgeber fehlerhaft als Referenzgruppe solche Studierendenhaushalte miteinbezogen, die lediglich über ein Einkommen in Höhe der BAföG-Leistungen verfügten. Mögliche Nebenverdienste der Studierenden und Kindergeld dürften ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Es müsse eine Differenzierung zwischen Kosten für den Lebensunterhalt und Kosten für die Ausbildung bzw. zwischen Kosten der Unterkunft und Kosten für die Heizung erfolgen. Die Bedarfssätze müssten zeitnah an sich ändernde wirtschaftliche Verhältnisse angepasst werden. Diese Vorgaben seien hier nicht beachtet worden.
Gewährleistung eines ausbildungsbezogenen Existenzminimums verfehlt
Das verfassungsrechtliche Teilhaberecht auf gleichberechtigten Zugang zu staatlichen Ausbildungsangeboten (Art. 12 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 des Grundgesetzes) verpflichte den Gesetzgeber, für die Wahrung gleicher Bildungschancen Sorge zu tragen und im Rahmen der staatlich geschaffenen Ausbildungskapazitäten allen entsprechend Qualifizierten eine (Hochschul-) Ausbildung zu ermöglichen. Dem hieraus folgenden Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung habe der Gesetzgeber mit den BAföG-Regelungen zwar dem Grunde nach Rechnung getragen. Er habe jedoch mit der konkreten Festlegung der für 2021 geltenden Bedarfssätze für Studierende – sowohl mit dem Grundbedarf als auch mit dem Unterkunftsbedarf – die Gewährleistung eines ausbildungsbezogenen Existenzminimums verfehlt.
Bundesverfassungsgericht
Das letzte Wort hat also Karlsruhe. Wann allerdings dort darüber entschieden wird, ist noch völlig unklar.
Quellen: VG Berlin, LAG Schuldnerberatung Hamburg e.V., Studis online,
Abbildung: Fotolia_105414150_Subscription_XXL.jpg