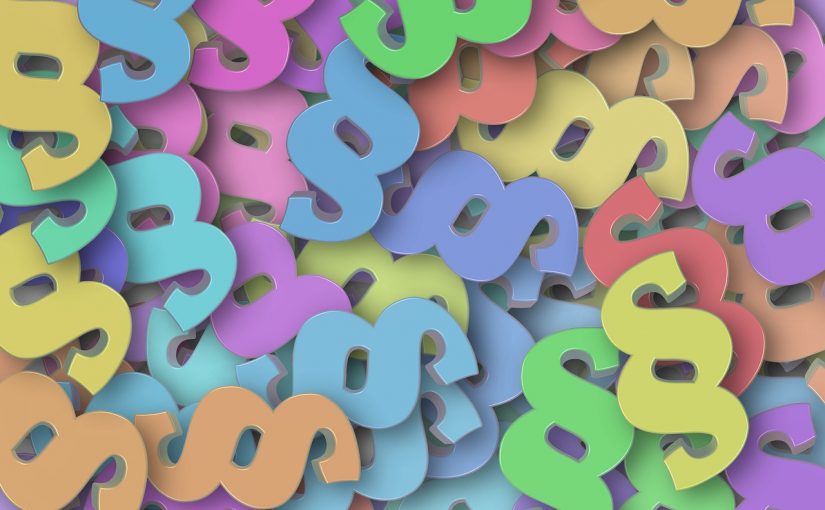Report Mainz veröffentlichte Ende Januar unter dem Titel: „Aufwachsen zwischen Tafel und Obdachlosenunterkunft“ eine Reportage über Kinderarmut in Deutschland. Die Tagesschau berichtete darüber am 25.2.2026.
Thematisch passt das gut zu unserem Artikel vom 20.2.26 über die geplante Kindergeldreform, vor allem zum letzten Absatz, in dem zum wiederholten Mal hier thematisiert wurde, dass der Kinder-Steuerfreibetrag, die steuerliche Entlastung für Betreuung, Erziehung und Ausbildung („BEA-Freibetrag“) wohlhabende Familien begünstigt.
Unicef zu Kinderarmut in Deutschland
Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland 2025 belegt die anhaltend hohe Armutsgefährdung: Jedes siebte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet, und insgesamt 1,9 Millionen Kinder leben in Familien, die auf Bürgergeld angewiesen sind. Für mehr als eine Million Kinder fehlen dadurch wesentliche Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe und späteren beruflichen Erfolg. Deutschland steht in puncto Armutsgefährdung von Kindern im Vergleich zu vielen wirtschaftlich stärkeren und auch schwächeren EU-Ländern schlecht da.
120 Euro pro Kind mehr
Wie der Staat ohne Mehrkosten die Kinderarmut bekämpfen kann, rechnet Marcel Fratscher vom DIW in der oben erwähnten Reportage vor. Danach würde die Streichung des BEA-Freibetrags 3,5 Milliarden Euro sparen. Jedes armutsgefährdete Kind könnte dadurch etwa 120 Euro mehr im Monat bekommen.
Das gängige Vorurteil, mehr Geld für Kinder würde gar nicht bei den Kindern ankommen, ist übrigens durch nichts belegt, wie Michael Klundt, Professor für Kinderpolitik von der Hochschule Magdeburg-Stendal darlegt.
und die Verfassung?
Auch das Argument, die Verfassung erlaube die Streichung des BEA-Freibetrags nicht, stimmt so nicht. Professorin Johanna Hey vom Institut für Steuerrecht der Universität zu Köln hat dies schon 2022 in einem Rechtsgutachten für den Bundestag erklärt: „Nicht zwingend verfassungsrechtlich geboten ist dagegen die Erhöhung des Freibetrags für den Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf des Kindes. Zwar steigen auch die Kinderbetreuungskosten, es geht hier aber nicht um die Steuerfreistellung des Existenzminimums. Vielmehr handelt es sich um eine familienpolitische Maßnahme; der aufwendungsunabhängige Freibetrag in § 32 Abs. 6 Satz 1, 2. Halbsatz EStG stellt im Einkommensteuerrecht einen Fremdkörper dar.“
Quellen: Tagesschau, Report Mainz, FOKUS-Sozialrecht, Bundestag
Abbildung: seminar_kinder-inklusion_AdobeStock_275230287_600x600@2x.jpg