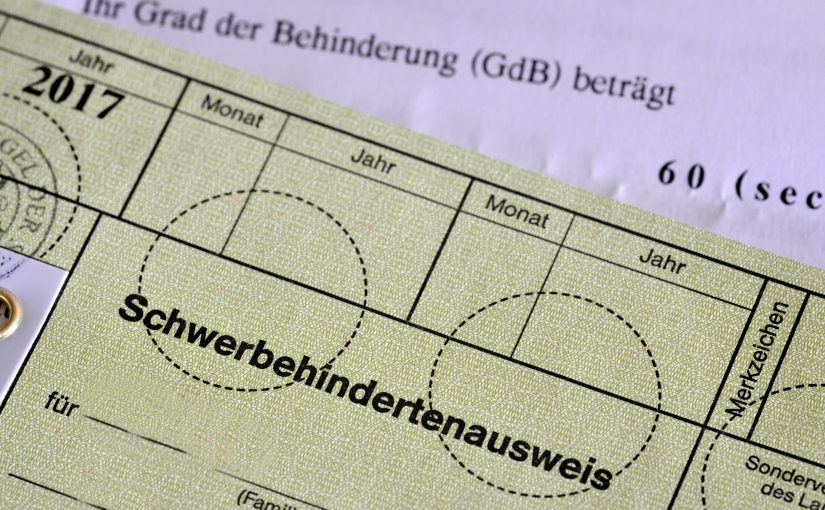Der erste „Report Pflegebedürftigkeit 2025“ des Medizinischen Dienstes Bund (MD Bund) analysiert die bundesweiten Daten aus den Pflegebegutachtungen von 2014 bis 2024. Im Jahr 2024 bezogen 5,6 Millionen Menschen Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung – das sind mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. Zeitgleich wuchs die Zahl der Begutachtungen auf über drei Millionen Gutachten an, davon knapp die Hälfte (47,9 %) im ambulanten Bereich als Erstantrag oder Höherstufung, während stationäre Erstbegutachtungen nur 12,3 % ausmachten.
Sechs Module der Begutachtung
Der Report beschreibt sechs Module der Begutachtung (z. B. Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, selbständige Lebensführung) und zeigt, dass bei Höherstufungsanträgen vor allem erhebliche und schwere Beeinträchtigungen vorliegen. Bei Erwachsenen erhielten 82,7 % der Erstantrags-Gutachten mindestens eine Empfehlung – am häufigsten für geriatrische Rehabilitation (62 %) sowie Heilmittel wie Physiotherapie oder Ergotherapie. Präventive Empfehlungen (z. B. Sturzprophylaxe) wurden in einem von fünf Gutachten ausgesprochen.
Kinder und Jugendliche
Ein Schwerpunkt des Reports liegt auf Kindern und Jugendlichen: Die Zahl der Begutachtungen bei unter 18‑Jährigen hat sich seit 2015 von 53.000 auf rund 162.000 mehr als verdreifacht. Fast 93,5 % dieser Gutachten betreffen ambulante Versorgung, meist zu Hause ohne professionelle Begleitung. Häufigste Diagnosen sind hyperkinetische Störungen (AD(H)S), Entwicklungsstörungen und Sprachentwicklungsstörungen, die zu Pflegebedürftigkeit führen. Ein Schwerpunkt des Reports liegt auf Kindern und Jugendlichen: Die Zahl der Begutachtungen bei unter 18‑Jährigen hat sich seit 2015 von 53.000 auf rund 162.000 mehr als verdreifacht. Fast 93,5 % dieser Gutachten betreffen ambulante Versorgung, meist zu Hause ohne professionelle Begleitung. Häufigste Diagnosen sind hyperkinetische Störungen (AD(H)S), Entwicklungsstörungen und Sprachentwicklungsstörungen, die zu Pflegebedürftigkeit führen.
Impulse für die Zukunft
Die bundesweite Befragung der Begutachteten zeigt hohe Zufriedenheitswerte: Über 86 % der Versicherten bewerten die Hausbesuchsgutachten positiv. Abschließend formuliert der Report Impulse für die Zukunft – insbesondere eine stärkere Orientierung der Begutachtung an den individuellen Versorgungs- und Lebensrealitäten der Antragstellenden sowie die Prüfung neuer digital gestützter Verfahren.
Reaktionen
Der VdK sieht in der verbesserten Erfassung durch die Pflegegrade einen Fortschritt: Mehr Betroffene können Leistungen in Anspruch nehmen, insbesondere niedrigere Pflegegrade im häuslichen Umfeld. Gleichzeitig fordert der Verband eine Stärkung von Prävention und Rehabilitation sowie eine Vereinfachung der Leistungen, da die Komplexität des Systems Betroffene und Angehörige überfordere.
Portale wie Familiara und Pflege.de heben hervor, dass viele Pflegebedürftige zwar Empfehlungen erhalten, diese jedoch nicht immer umgesetzt werden können, weil Betroffene und Angehörige zu wenig über die Angebote informiert sind. Sie fordern gezieltere Beratungsangebote und eine transparente Kommunikation der Gutachtenergebnisse, um die im Report genannten Potenziale tatsächlich auszuschöpfen.
Quellen: Medizinischer Dienst Bund, VDK, Familiara,
Abbildung: fotolia_98808551.jpg