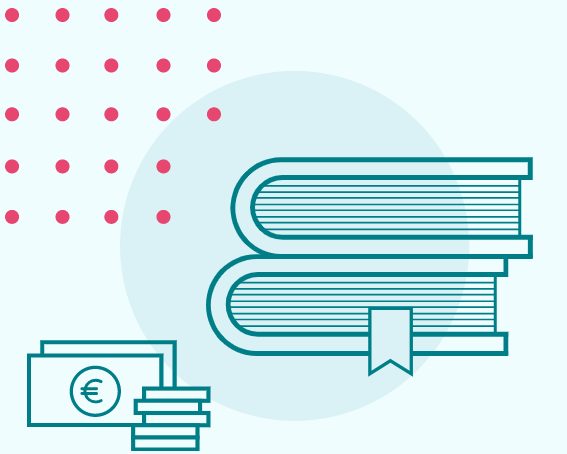Der Beirat für Ausbildungsförderung veröffentlichte am 5. Februar eine Stellungnahme zu dem vom Forschungsministerium im November 2025 vorgelegten Bericht zur Überprüfung der Bedarfssätze, Freibeträge sowie Vomhundertsätze und Höchstbeträge im BAFöG.
Wer ist der Beirat?
Im Beirat sind Vertreter
- der an der Ausführung des Gesetzes beteiligten Landes- und Gemeindebehörden,
- des Deutschen Studentenwerkes e. V.,
- der Bundesagentur für Arbeit, der Lehrkörper der Ausbildungsstätten,
- der Auszubildenden,
- der Elternschaft,
- der Rechts-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften,
- der Arbeitgeber sowie
- der Arbeitnehmer
berufen. Er berät das Ministerium bei
- der Durchführung des Gesetzes,
- der weiteren Ausgestaltung der gesetzlichen Regelung der individuellen Ausbildungsförderung und
- der Berücksichtigung neuer Ausbildungsformen
Stellungnahme
Nach den vorliegenden Daten der BAföG-Statistik des Jahres 2024 konnte weder der langjährige Rückgang der Gefördertenzahlen gestoppt, noch eine Trendumkehr eingeleitet werden.
Anpassung und Dynamisierung
Der Beirat hält eine zügige und spürbare Anpassung der Bedarfssätze sowie insbesondere der Wohnkostenpauschale und Sozialpauschalen für notwendig. Um das Vertrauen in die Verlässlichkeit der staatlichen Ausbildungsförderung auch künftig sicherzustellen, sollten die BAföG-Leistungen dynamisiert werden. Hierzu empfiehlt der Beirat die Entwicklung einer Bezugsgröße, die den Bedarf aller Auszubildenden realistisch wiedergibt. Hinsichtlich der Freibeträge vom Einkommen der Eltern empfiehlt der Beirat eine automatische Dynamisierung gekoppelt an die jährliche Inflationsrate.
Verfahren vereinfachen
Das Bafög-Verfahren muss nach Ansicht des Beirates für Ausbildungsförderung vereinfacht werden. Dazu seien neben der Veränderung der Formblätter auch gesetzliche Reformen notwendig. So sollten die Notwendigkeit und der Umfang der Nachweiserbringung kritisch überprüft werden. Eine wichtige Vereinfachung wäre dem Bericht zufolge die Einführung des Once-only-Prinzips: was die eine Behörde schon weiß, sollte eine andere bei Antragstellern nicht mehr abfragen.
Digitalisierung
Das Ziel müsse sein, ein vollständig digitales Bafög-Verfahren zu etablieren. Eine kürzere Bearbeitungsdauer werde sich aber nur realisieren lassen, wenn mit der Digitalisierung eine Vereinfachung des Bafög-Verfahrens einhergehe, heißt es in dem Bericht weiter.
Förderung von Schülern
Angesichts sinkender sozialer Mobilität spricht sich der Beirat außerdem für eine Förderung von Schülern unabhängig davon aus, ob sie bei ihren Eltern wohnen oder nicht.
Quellen: Bundestag, FOKOS_Sozialrecht
Abbildung: Fotolia_105362974_Subscription_XXL.jpg