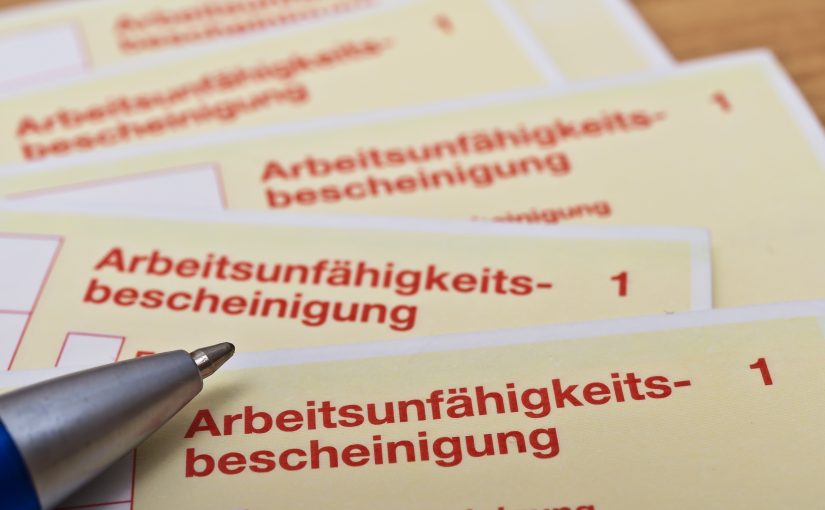Das Bundeskabinett hat das Zweite Familienentlastungsgesetz beschlossen. Schon während der Debatte um das Erste Familienentlastungsgesetz im Herbst 2018 wurde bekannt, dass eine weitere Kindergelderhöhung um 15 Euro für den 1.1.2021 geplant sei. Dies wird nun verwirklicht. Die Regierung nimmt damit die Ergebnisse des noch nicht veröffentlichten 13. Existenzminimumberichtes vorweg.
Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag
Zum 1. Januar 2021 steigt das Kindergeld um 15 Euro und beträgt damit
- für das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro,
- für das dritte Kind 225 Euro und
- für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 Euro.
Der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf für die Einkommenssteuer wird pro Elternteil um 144 Euro angehoben. Damit kommt ein Elternpaar insgesamt auf eine Summe von 8.388 Euro jährlich, auf die keine Einkommenssteuer fällig wird.
Erhöhung von Grundfreibetrag und Unterhaltshöchstbetrag
Der Grundfreibetrag für Erwachsene steigt ebenfalls an. Von jetzt 9.408 Euro steigt er
- 2021 auf 9.696 Euro und
- 2020 auf 9.984 Euro.
Satire?
Die Bundesregierung schreibt auf ihrer Webseite dazu unter anderem folgende bemerkenswerte Sätze: „Der Koalitionsvertrag sieht aber vor, den Kinderfreibetrag an die Kindergeld-Erhöhung zu koppeln. Deshalb übersteigt der Freibetrag das Kinderexistenzminimum. So setzt sich die Bundesregierung nachhaltig gegen Kinderarmut ein.“
Kinderarmut grassiert hauptsächlich unter den Menschen die auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind. Dort kommt das Kindergeld und natürlich auch die Erhöhung gar nicht an.
Auch Alleinerziehende, die für ihre Kinder Unterhaltsvorschuss beziehen, haben nach einer Kindergelderhöhung nicht mehr Geld zur Verfügung als vorher, weil das Kindergeld – anders als beim Unterhalt – in vollem Umfang auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet wird. Der Betrag des Unterhaltsvorschusses sinkt so um den Betrag, um den das Kindergeld erhöht wurde.
Höhere Einkommen profitieren wie auch bisher von den Kinderfreibeträgen, wie ein Beispiel aus SOLEX zeigt (Zahlen nach dem Stand vom 1.1.2020):
Beispiel
Ein Ehepaar erzielt ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe von 120.000 EUR (ohne Berücksichtigung eines Kinderfreibetrages) und hat 2 Kinder.
Variante 1: Kindergeld
Kindergeld für 2 Kinder führt zu einer Vergünstigung in Höhe von 4.896 EUR pro Jahr.
Variante 2: Kinderfreibetrag
Der Kinderfreibetrag beträgt bei Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, pro Kind und Monat 651 EUR. Daraus ergibt sich für zwei Kinder pro Jahr insgesamt ein Freibetrag in Höhe von 15.624 EUR. Bei einem zu versteuernden Einkommen in Höhe von 120.000 EUR ergibt sich eine Steuerbelastung in Höhe von 32.472 EUR. Der Kinderfreibetrag senkt das zu versteuernde Einkommen auf 104.376 EUR und die Steuerbelastung entsprechend auf 26.010 EUR. Damit beträgt die Steuerersparnis aufgrund des Freibetrages 6.462 EUR.
Ergebnis:
Die Steuervariante führt gegenüber der Kindergeldvariante zu einem um 1.566 EUR besserem Ergebnis. Das entspräche einem monatlichen Kindergeld pro Kind von 269 Euro.
Fazit
Für kleine und mittlere Einkommen ist die Kindergelderhöhung positiv, zumal sie vielleicht sogar stärker ausfallen wird als der kommende Existenzminimumbericht hergibt. Höhere Einkommen profitieren wie immer am meisten.
Bei den Kindern, die von Armut betroffen sind, kommt aber gar nichts an. Die großspurig angekündigte Bekämpfung der Kinderarmut durch die Bundesregierung findet nicht statt.
Quellen: Bundesregierung, SOLEX, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: pixabay.com children-593313_1280.jpg