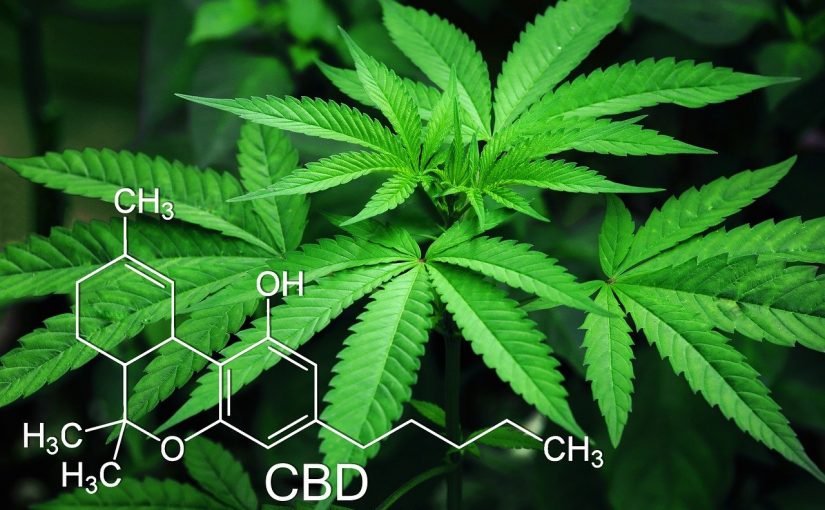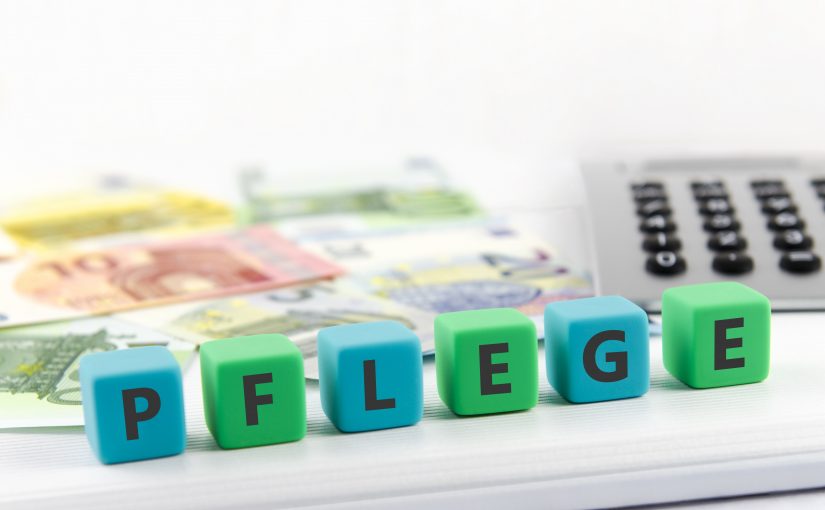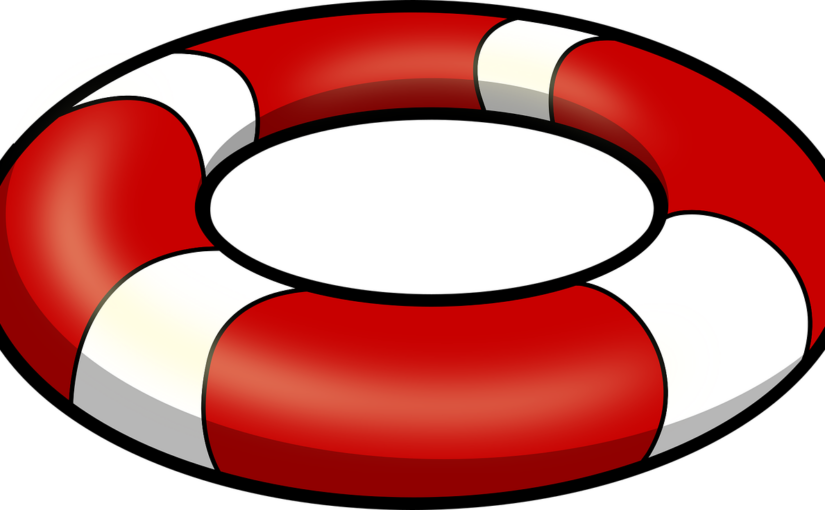Der Bundestag hat beschlossen, den inklusiven Arbeitsmarkt stärker zu fördern. Ausführlich hatten wir im Januar über den Entwurf berichtet Der Bundesrat stimmt am 12. Mai 2023 über die Änderungen im Sozialrecht ab. Sie bedürfen der Zustimmung der Länderkammer, um in Kraft treten zu können.
Das Gesetz zielt darauf ab, mehr Menschen mit Behinderungen in reguläre Arbeit zu bringen, mehr Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Arbeit zu halten und zielgenauere Unterstützung für Menschen mit Schwerbehinderung zu ermöglichen.
Höhere Ausgleichsabgabe
Dies soll unter anderem durch die Erhöhung der Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber erreicht werden, die trotz Beschäftigungspflicht keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Für kleinere Arbeitgeber sind wie bisher Sonderregelungen vorgesehen.
Schon bislang müssen Arbeitgeber auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Diese Regelung gilt für Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen. Für jeden nicht mit einem schwerbehinderten Menschen besetzten Pflichtarbeitsplatz wird eine Ausgleichsabgabe fällig: 140 Euro bei einer Beschäftigungsquote von 3 bis 5 Prozent, 245 Euro bei einer Beschäftigungsquote von 2 bis weniger als 3 Prozent und 360 Euro bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent. Das Gesetz sieht eine neue vierte Staffel vor: Liegt die Beschäftigungsquote bei 0 Prozent, sind 720 Euro zu zahlen.
Zu viele Arbeitgeber beschäftigten keine Schwerbehinderten
Die Gesetzesbegründung verweist darauf, dass noch immer etwa 45.000 beschäftigungspflichtige Arbeitgeber – rund ein Viertel – keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigten. Diese Arbeitgeber sollen eine höhere Ausgleichsabgabe zahlen als diejenigen Arbeitgeber, die wenigstens in geringem Maße schwerbehinderte Menschen beschäftigen.
Weitere Neuerungen
Die Mittel aus der Ausgleichsabgabe sollen sich künftig auf die Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt konzentrieren.
Für Anspruchsleistungen des Integrationsamtes wird eine Genehmigungsfiktion nach sechs Wochen eingeführt, um die Bewilligungsverfahren zu beschleunigen.
Die Deckelung für den Lohnkostenzuschuss beim Budget für Arbeit wird aufgehoben, dadurch soll sichergestellt werden, dass auch nach Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro bundesweit der maximale Lohnkostenzuschuss – soweit nach den Umständen des Einzelfalls erforderlich – gewährt werden kann.
Außerdem richtet das Gesetz den Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizinische Begutachtung neu aus.
Quelle: Bundesrat
Abbildung: Fotolia_62030397_Subscription_XXL.jpg