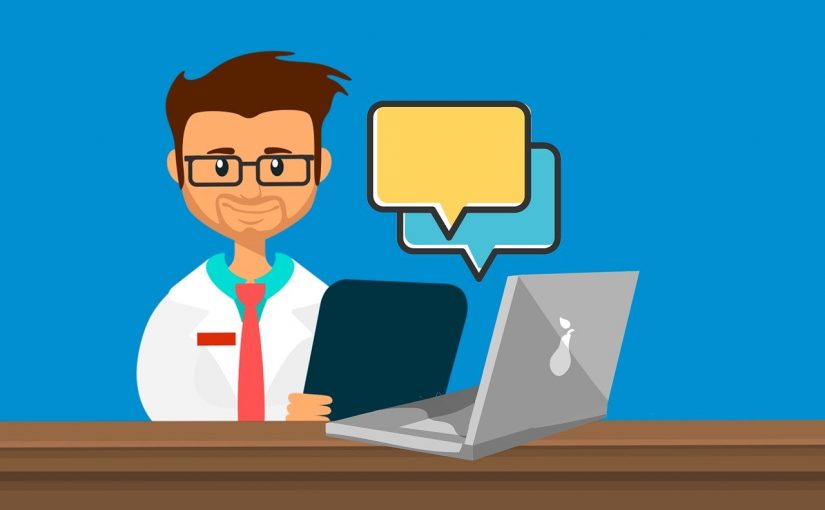Human Rights Watch (HRW) hat im Februar 2024 einen Bericht mit dem Titel „Es zerreißt einen: Armut und Geschlecht im deutschen Sozialstaat“ veröffentlicht. Der Bericht untersucht die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Armut in Deutschland und kommt zu dem Schluss, dass das deutsche Sozialsystem die Menschenrechte der Betroffenen nicht ausreichend schützt.
Zentrale Erkenntnisse des Berichts
Frauen sind in Deutschland einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt als Männer. Dies gilt insbesondere für Alleinerziehende, ältere Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund. Der Bericht zeigt, dass die Höhe der Sozialleistungen nicht ausreicht, um ein menschenwürdiges Leben zu gewährleisten.
Interviews mit armutserfahrenen Menschen
Auf der Grundlage von zahlreichen Interviews mit armutserfahrenen Menschen und nach Analyse der aktuellen sozialpolitischen Entwicklungen – insbesondere Bürgergeld und Kindergrundsicherung – kommt HRW zu dem Ergebnis, dass die Menschenrechte von einkommensarmen Menschen in Deutschland verletzt werden – insbesondere Alleinerziehende und ältere Frauen seien betroffen.
Leistungen des Bürgergeldes unterhalb der Armutsschwelle
So stellt HRW etwa heraus, dass die Leistungen des Bürgergeldes deutlich unterhalb der Armutsschwelle liegen (jeweils ohne Wohnkosten). In der Pressemitteilung von HRW heißt es dazu: „So erhält beispielsweise ein Haushalt mit einem / mit einer Alleinerziehenden und zwei Kindern 1.198 Euro an Sozialleistungen, während die Armutsgrenze bei 1.626 Euro liegt. Das entspricht einer Differenz von 26 Prozent. Die Lücke für eine*n alleinstehende*n Erwachsene*n beträgt 51 Prozent“. HRW kommt angesichts dieser Zahlen zu dem Schluss, dass „die Höhe der Sozialleistungen nicht ausreicht, um Deutschlands völker- und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen“.
Mängel im Sozialsystem
Das Sozialsystem berücksichtigt die spezifischen Bedürfnisse von Frauen nicht ausreichend. Bestehende Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt, wie der Gender Pay Gap, tragen zur geschlechtsspezifischen Armut bei.
Forderungen von HRW
HRW fordert die Bundesregierung auf, die Sozialleistungen zu erhöhen und das Sozialsystem geschlechtersensibler zu gestalten. Zudem sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Gleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu fördern.
Wer steckt hinter Human Rights Watch?
Human Rights Watch (HRW) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für den Schutz der Menschenrechte einsetzt. Die Organisation wurde 1978 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York City. HRW führt Recherchen zu Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Ländern durch und veröffentlicht Berichte, um auf diese aufmerksam zu machen. HRW ist bekannt für seine unparteiische und gründliche Recherche.
Quellen: HWR, Paritätischer Gesamtverband, wikipedia
Abbildung: pixabay.com justitia.jpg