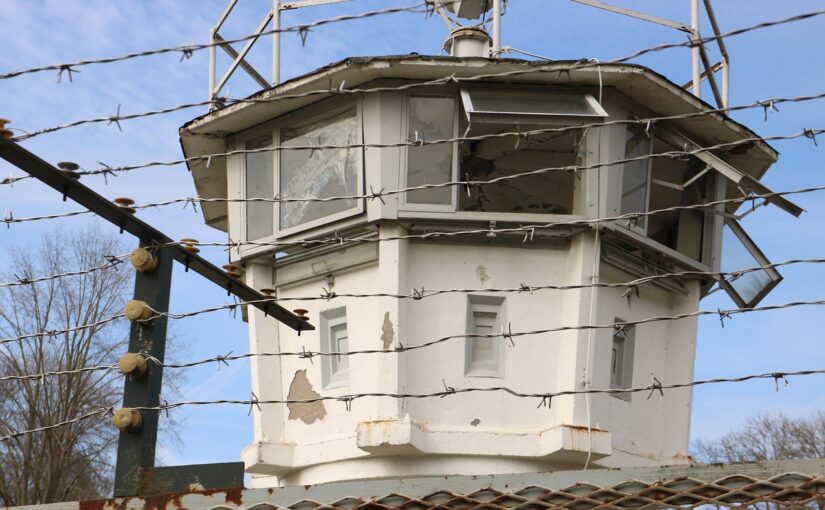Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales legt den Referentenentwurf zur Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2025 vor:
Die Rechengrößen werden jedes Jahr gemäß der Einkommensentwicklung angepasst. Maßgebend für 2025 ist das Jahr 2023. Bei der Ermittlung der jeweiligen Einkommensentwicklung zählen die Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer.
Ost-West Angleichung
Durch das Gesetz zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung (Renten-Überleitungsgesetz – RÜG) wurde die Rentenüberleitung der DDR-Alterssicherung in die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland geregelt. Bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse in ganz Deutschland sollten für die neuen Bundesländer andere Berechnungsgrößen als für die alten Bundesländer gelten. Die unterschiedlichen Rechengrößen (Umrechnungsfaktor, Bezugsgröße, Beitragsbemessungsgrenze, aktueller Rentenwert) werden schrittweise bis zum 31. Dezember 2024 angeglichen. Ab dem 1. Januar 2025 gelten einheitliche Rechengrößen für beide Rechtskreise.
Lohnzuwachsrate
Um die maßgebenden Werte der Rechengrößen der Sozialversicherung für das Jahr 2025 zu bestimmen, werden die Werte für das Jahr 2024 mit der Veränderungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (Lohnzuwachsrate) im Jahr 2023 fortgeschrieben. Die gesamtdeutsche Lohnzuwachsrate im Jahr 2023 beträgt 6,44 Prozent. Für die Bestimmung des (endgültigen) Durchschnittsentgelts für das Jahr 2023 ist nach den gesetzlichen Vorschriften die Lohnzuwachsrate im Jahr 2023 für die alten Länder in Höhe von 6,37 Prozent maßgebend.
Bezugsgröße
Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung Bedeutung hat (unter anderem für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Beitragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung), beträgt ab 1. Januar 2025
- 3.745 Euro/Monat (2024: 3.535 Euro/Monat West, 3.465 Euro/Monat Ost).
Versicherungspflichtgrenze und Beitragsbemessungsgrenze
Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) steigt auf 73.800 Euro (2024: 69.000 Euro).
Die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2025 in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf 66.150 Euro jährlich (2024: 62.100 Euro) bzw. 5.512,50 Euro monatlich.
Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung klettert
- auf 8.050 Euro/Monat (2024: 7.550 Euro/Monat West, 7.450 Euro/Monat Ost).
Zusammenfassung
Zusammengefasst ergeben sich nach dem Referentenentwurf folgende Werte:
| Monat | Jahr | |
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung | 8.050 € | 96.600 € |
| Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche RV | 9.900 € | 118.800 € |
| Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung | 8.050 € | 96.600 € |
| Versicherungspflichtgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 6.150 € | 73.800 € |
| Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 5.512,50 € | 66.150 € |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.745 € | 44.940 € |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung für 2025 | 50.493 € | |
| endgültiges Durchschnittsentgelt 2022 in der Rentenversicherung | 44.732 € | |
Parlamentarischer Weg
Bevor die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2025 im Bundesgesetzblatt verkündet wird, muss sie von der Bundesregierung beschlossen werden und der Bundesrat muss anschließend zugestimmt haben.
Quelle: BMAS
Abbildung: pixabay.com coins-1726618_1920.jpg