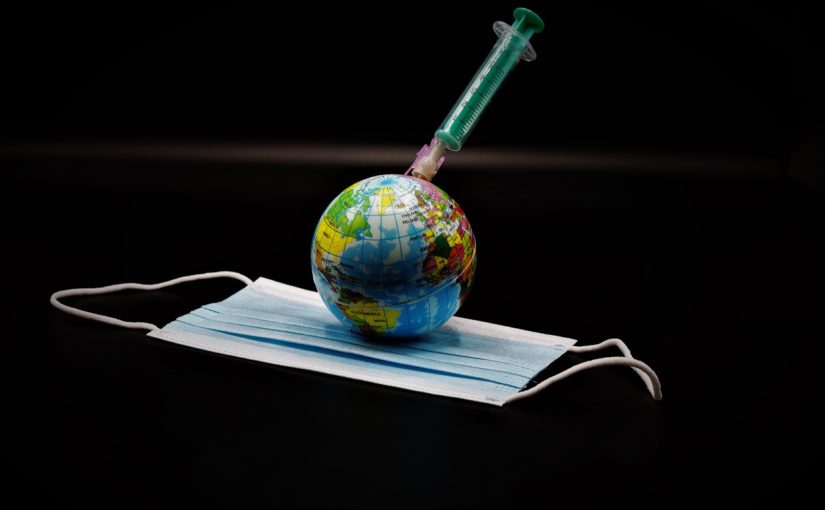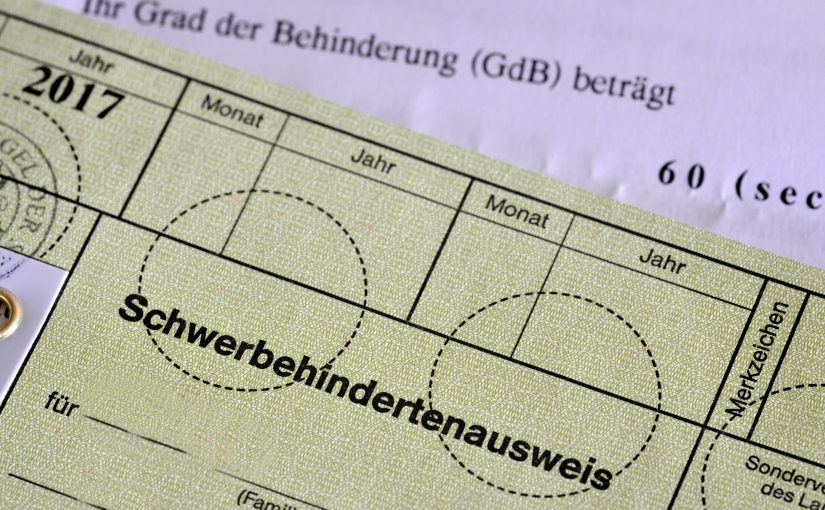Ab dem 1. August 2021 gilt eine Testpflicht für Reiserückkehrer. Dazu wurde kurzfristig die Einreiseverordnung geändert. Die Bundesregierung beruft sich dabei auf die Verordnungsermächtigung nach § 36 Absatz 8 Satz 1 und Absatz 10 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes.
Was ist neu?
Bislang gilt die Testpflicht schon für die Einreise mit dem Flugzeug aus jedem anderen Land. Ab Sonntag gilt sie auch für Reisen mit der Bahn, im Bus, auf dem Schiff und im Individualverkehr.
Nun müssen alle Personen ab 12 Jahren bei ihrer Einreise in die Bundesrepublik Deutschland einen aktuellen Testnachweis vorlegen, es sei denn, sie sind geimpft oder genesen.
Hochrisikogebiete
Zugleich werden die Einreiseregeln vereinfacht, indem die Kategorie der „einfachen“ Risikogebiete entfällt. Es gelten künftig nur noch zwei Kategorien: Die bisherigen Hochinzidenzgebiete werden zu Hochrisikogebieten. Als Virusvariantengebiete gelten weiterhin Länder und Regionen, in denen besonders gefährliche Virusvarianten nachgewiesen sind. Das sind insbesondere solche Varianten, gegen die in Deutschland eingesetzte Impfstoffe keinen oder nur einen eingeschränkten Schutz bieten. Welche Staaten und Regionen derzeit als Hochrisikogebiet gelten, kann man beim Robert-Koch-Institut nachlesen.
Virusvariantengebiete
Die Regelungen für Virusvariantengebiete bleiben unverändert. Allerdings wird ein Virusvariantengebiet nur dann als solches ausgewiesen, wenn es besonders gefährliche Virusvarianten in diesem Gebiet gibt. Das sind insbesondere solche Virusvarianten, gegen die bestimmte in der Europäischen Union zugelassene Impfstoffe oder eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 keinen oder nur einen eingeschränkten Schutz bieten oder die andere ähnlich schwerwiegende Eigenschaften aufweisen, weil sie z. B. schwerere Krankheitsverläufe oder eine erhöhte Mortalität verursachen.
Für diese Gebiete bleiben die strengen Regeln bestehen. Es gilt das Beförderungsverbot aus Virusvariantengebieten. Personen, die nach Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiete einreisen (z. B. Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland, die vom Beförderungsverbot ausgenommen sind), müssen über einen Testnachweis verfügen, sich über die digitale Einreiseanmeldung registrieren und sich in der Regel für 14 Tage absondern.
Zurzeit gelten nur Uruguay und Brasilien als Virusvariantengebiet.
Welche Tests gelten?
Alle Einreisenden müssen entweder einen Nachweis erbringen, dass sie geimpft oder genesen sind. Oder sie müssen ein negatives Testergebnis vorweisen können. Bei Antigentests darf es maximal 48 Stunden alt sein, bei PCR-Tests 72 Stunden. Bei Einreise aus einem Virusvariantengebieten muss ein Testnachweis vorgelegt werden (72 h PCR-Test, Antigentest hier nur 24 h).
Kosten
Der Test muss vor Einreise erfolgen. Wenn es im Reiseland keine kostenlosen Tests gibt, müssen Einreisende die Kosten also selbst tragen.
Kinder
Kinder unter 12 Jahren benötigen bei der Einreise keinen Nachweis – die Nachweispflicht gilt erst für Personen ab 12 Jahre.
Nach Voraufenthalt in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet müssen sich Kinder jeglichen Alters – wie bislang – in Quarantäne begeben. Es gelten dieselben Regeln wie für Erwachsene.
Personen unter 12 Jahren werden bei Voraufenthalt in einem Hochrisikogebiet 5 Tage nach der Einreise automatisch von der Quarantäne befreit. Bislang war hierfür ein Testnachweis oder Genesenennachweis nötig.
Ausnahmen
Ausnahmen von der Nachweispflicht sind z. B. für Grenzpendler und Grenzgänger (Personen, die aus beruflichen Gründen, zu Studien- oder Ausbildungszwecken regelmäßig eine Grenze überqueren) sowie Tagespendler (die sich weniger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten bzw. nach weniger als 24 Stunden wieder in Deutschland einreisen) vorgesehen. Grenzgänger, Grenzpendler und Tagespendler müssen bei Einreise aus einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet allerdings über einen Nachweis verfügen. Personen, die keinen Impfnachweis oder Genesenennachweis haben, benötigen einen Testnachweis lediglich zweimal pro Woche. Für Einreisen per Flugzeug gelten diese Ausnahmen nicht.
Mehr Informationen
Beim Bundesgesundheitsministerium gibt es zu den neuen Regelungen eine „Frage und Antwort„-Seite, sowie eine Kurzübersicht über die neuen Regelungen.
Quellen, BMG, RKI
Abbildung: pixabay.com corona-5198347_1280.jpg