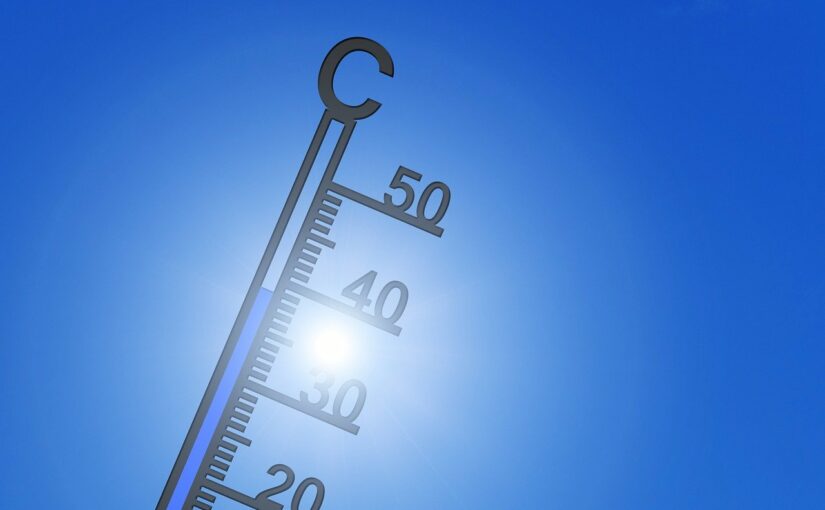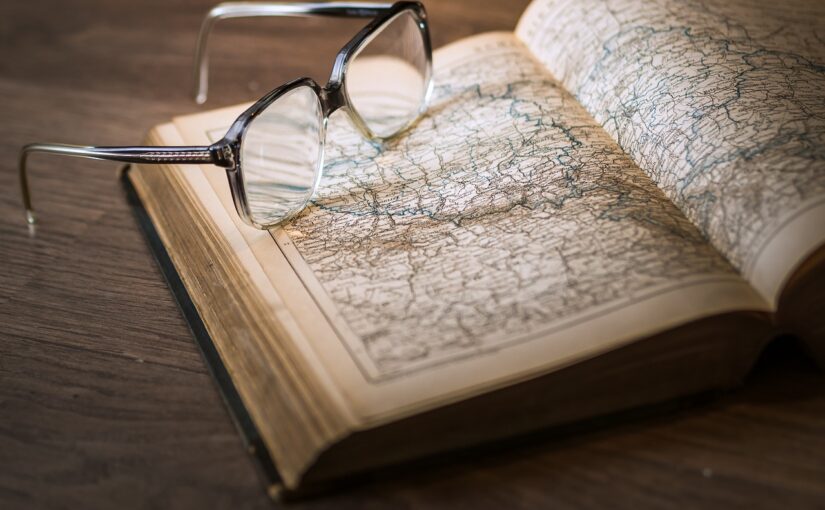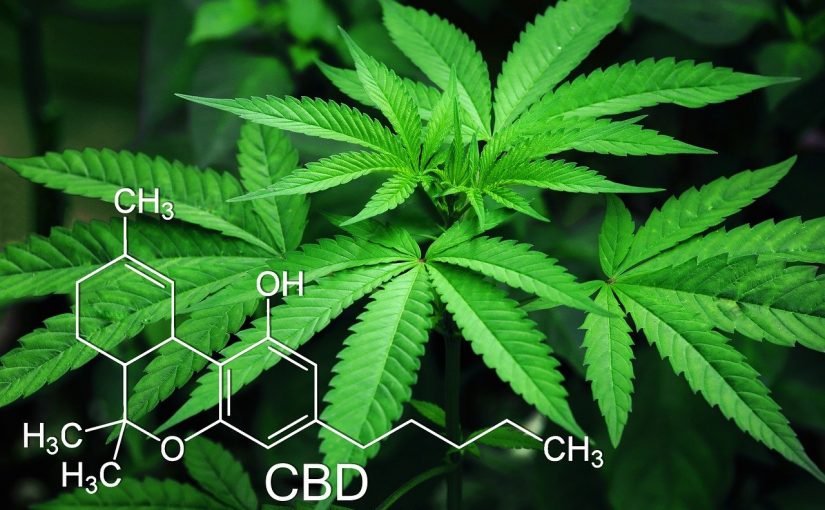Christian Lindner, strikter Verteidiger der Schuldenbremse, will also eine Menge Schulden machen, um die Rentenbeiträge auf Dauer nicht in die Höhe zu treiben. Das ist zumindest erklärungsbedürftig. Vielleicht hat es ja damit zu tun, dass der Finanzminister doch den Unterschied zwischen Schulden und Investitionen kennt. Auf Bundesebene werden dringende Investitionen in Klimaschutz, Bildung Gesundheitsversorgung und Infrastruktur blockiert, weil diese „Schulden“ ja die nächsten Generationen belasten würden. Als ob sich unsere Kinder darüber feuen würden, wenn wir ihnen ein marodes Land hinterlassen und ihnen die unbezahlbaren Kosten für die Folgen des Klimawandels aufbürden. Hauptsache wenig Schulden.
200 Milliarden
Um das im Rentenpaket II vorgesehene kreditfinanzierte Generationenkapital aufzubauen, müssen, wie der Name schon sagt, Schulden gemacht werden (mindestens 200 Milliarden übrigens), oder sind es Investitionen? Mit Darlehen aus dem Bundeshaushalt und Vermögenswerten vom Bund soll ein Kapitalstock aufgebaut werden. Seine Erträge sollen künftig dazu beitragen, die Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung zu stabilisieren. Die Gelder aus dem Generationenkapital müssen als Ausschüttung an die gesetzliche Rentenversicherung verwendet werden. Ab 2036 sind Ausschüttungen von durchschnittlich zehn Milliarden Euro jährlich vorgesehen. Beitragsgelder fließen nicht in das Generationenkapital.
Riskant und keine Entlastung
Dieses Konstrukt beruht auf dem Prinzip Hoffnung, dass bei allen Risiken und Schwankungen des Kapitalmarktes verlässliche Erträge zu erzielen wären. Dies sei riskant und bringe kurz und mittelfristig keinerlei Entlastung, so die Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes.
Johannes Geyer, Experte für Staatsfinanzen beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sagt: „Die Bundesregierung betreibt hier in erster Linie Symbolpolitik. Die Summen, um die es geht, sind im Verhältnis zum Geld, das wir für die gesetzlichen Rentenkassen benötigen, quasi nichts.“ Um die abzusehende Finanzlücke aufzufüllen, hat das DIW ausgerechnet, bräuchte es eher 800 bis 900 Milliarden Euro anstatt 200. Dies berichtet correctiv am 30.Mai 2024.
Verwaltet und global angelegt werden soll das Generationenkapital von einer unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Stiftung. Für die Aufgaben der Stiftung sollen zunächst die operativen Strukturen des „Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung“ (KENFO), einem bereits etablierten öffentlichen Vermögensverwalter, genutzt werden. Investitionen also global. Es spricht nichts gegen globale Investitionen, es sei denn, nationale Investitionen werden gleichzeitig als „Schulden“ diffamiert und verhindert.
Wer ist KENFO?
Der KENFO wurde 2017 eingerichtet und soll die Finanzierung der sicheren Entsorgung der radioaktiven Abfälle aus der gewerblichen Nutzung der Kernenergie in Deutschland sicherstellen. Bei der Geldanlage sollen neben der Rendite auch die Kriterien Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (auch Environment Social Governance–Kriterien oder ESG–Kriterien) in die Anlagestrategie integriert werden. Diese Kriterien zu erfüllen, scheint nicht recht zu gelingen. So hatte der KENFO Ende 2021 757,9 Millionen Euro in Öl- und Gasunternehmen investiert, sowie 26 Millionen Euro in den russischen Ölkonzern Lukoil. Außerdem hatte der Fonds in Großbanken investiert, die in den Cum-Ex-Skandal verwickelt waren und gegen die von den Staatsanwaltschaften in Köln und Frankfurt ermittelt wurde. Mehr über KENFO im Handelsblatt vom 6.März 2023.
Rentenpaket II im Kabinett verabschiedet
Der Gesetzentwurf zur Rente („Rentenniveaustabilisierungs- und Generationenkapitalgesetz“) wurde am 29.5.2024 im Kabinett verabschiedet. Neben der Einführung des Generationenkapital enthält das Paket als zweiten Schwerpunkt die Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 Prozent bis 2039. Mehr dazu in unserem Beitrag vom März 2024 oder auf der Homepage der Bundesregierung.
Quellen: Bundesregierung, FOKUS-Sozialrecht, Paritätischer Gesamtverband, ZEIT-online, wikipedia, correctiv.org, Handelsblatt
Abbildung: Fotolia_158866271_Subscription_XXL.jpg