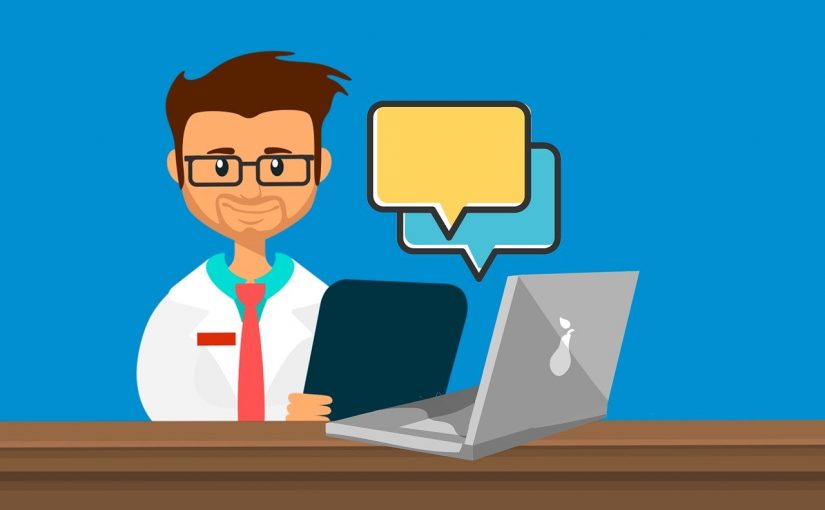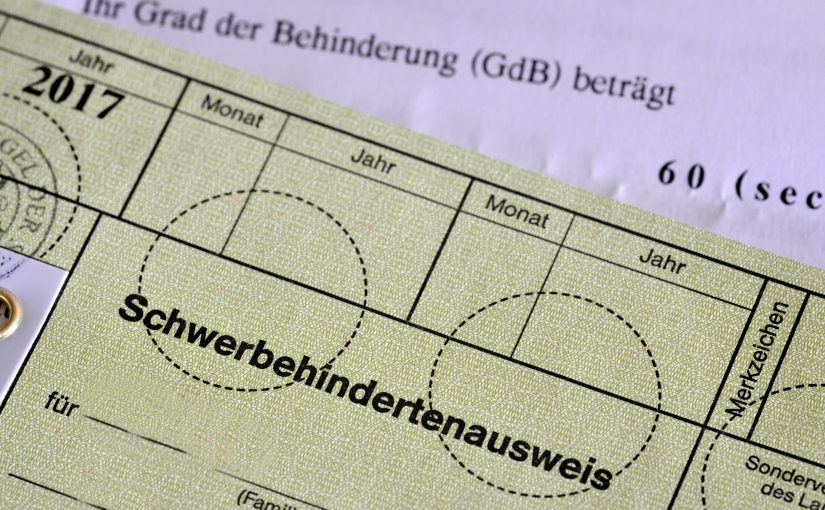Mit dem Ende der Ampel-Koalition und der anstehenden Neuwahl des Deutschen Bundestages stehen viele Gesetzesvorhaben vor einer ungewissen Zukunft. Noch nicht verabschiedete Gesetzesvorhaben verfallen mit dem Ende der Legislaturperiode (sog. Diskontinuitätsprinzip).
Trotz #Ampelaus und geplanter Beantragung der Vertrauensfrage tagt das Bundeskabinett wöchentlich und beschließt weiterhin fleißig die Einbringung von Gesetzesvorhaben. Dies war auch in der Kabinettssitzung am 11.12.2024 wieder der Fall. Beschlossen wurde u. a. eine Formulierungshilfe zum „Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung und zur Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern“ – genauer gesagt eine „Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Gesetzentwurf“.
Was bedeutet das vom Gesetzgebungsprozess her?
- „Formulierungshilfe“: Eine Formulierungshilfe ist ein Textenwurf, der von der Bundesregierung, in der Regel von den zuständigen Ministerien, erarbeitet wird. Dieser Text dient als Grundlage für einen späteren Gesetzentwurf.
- „für die Koalitionsfraktionen“: Diese Formulierung weist darauf hin, dass die Bundesregierung den Entwurf speziell für die Fraktionen der Parteien, die die Regierung bilden (die Koalitionsfraktionen), erarbeitet hat.
- „für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Gesetzentwurf“: Diese Formulierung bedeutet, dass der Gesetzentwurf formell von Abgeordneten der Koalitionsfraktionen und nicht von der Bundesregierung eingebracht werden soll. Ein Gesetzesvorhaben, das „aus der Mitte des Bundestages“ kommt, muss von einer Fraktion oder von mindestens fünf Prozent der Bundestagsabgeordneten unterzeichnet und eingebracht werden. Dies bestimmt die Geschäftsordnung des Bundestages in § 76 Absatz 1.
Was bedeutet das zeitlich?
- Es müssen sich genügend Bundestagsabgeordnete (oder eine Fraktion) finden, die den Gesetzentwurf in die Hand nehmen und in den Bundestag einbringen. Ist dies geschehen, nimmt das Gesetzgebungsverfahren seinen Lauf:
- Initiativen aus dem Bundestag gehen an den Bundesrat, der dazu Stellung nimmt, diese Stellungnahme geht dann zurück an die Initiatoren. Dies geschieht in der Regel innerhalb von sechs Wochen. Besonders eilige Vorlagen können bereits nach drei Wochen dem Bundestag zugeleitet werden, die Stellungnahme des Bundesrates wird nachgereicht.
- Nun beginnen die Lesungen im Bundestag. In der ersten Lesung (Beratung) findet eine allgemeine Aussprache über die Notwendigkeit und den Zweck eines Gesetzes statt.
- Nach der ersten Beratung wird der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung und Bearbeitung an den zuständigen Ausschuss überwiesen und dort ausführlich beraten (im Rahmen von Anhörungen, teilweise mit externen Sachverständigen). Am Ende steht ein schriftlicher Bericht mit einer Beschlussempfehlung, der dem Plenum des Bundestages zur zweiten Beratung vorgelegt wird.
- In der zweiten Beratung findet eine Aussprache über den Gesetzentwurf, den Bericht des Ausschusses und dessen Änderungsanträge statt. Anschließend wird abgestimmt. Unmittelbar daran schließt sich die dritte Beratung an. Sie endet mit der Schlussabstimmung.
- Der Bundestagspräsident leitet den Gesetzesbeschluss dem Bundesrat zu. Dort wird er einem oder mehreren Ausschüssen des Bundesrates zur Beratung zugewiesen, über deren Beschlussempfehlung dann das Plenum des Bundesrates abstimmt (zweiter Durchgang im Bundesrat).
Warum diese ausführliche Beschreibung?
Trotz Pressemitteilungen oder Social-Media-Aktivitäten: Ein Gesetzgebungsverfahren folgt einem strikten Ablauf … und der braucht seine Zeit. Und das ist angesichts der angestrebten Bundestagswahl am 23.2.2025 ein echtes Problem.
Schaut man sich die Terminpläne von Bundestag und Bundesrat an, wird deutlich, dass die Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag eine enge Kiste wird. Diese Plenumssitzungen sind terminiert:
16.12. Vertrauensfrage
17.12.-20.12. Plenum; nach derzeitiger Tagesordnung findet sich noch kein Topic für den Gesetzentwurf
Weitere Plenarsitzungen sind terminiert für den 27.01.-31.01. und 10.02.-11.02.2025.
Dann ist „Schicht im Schacht“. Wenn am 11.02.2025 das Gesetz nicht in 2./3. Lesung durch ist, dann unterliegt es der Diskontinuität.
Freilich .. theoretisch wäre es möglich, dass sich der Bundestag zu außerordentlichen Sitzungen im Plenum zusammenfindet. Da aber ab Januar 2025 der Wahlkampf auf Hochtouren läuft, ist das eher unwahrscheinlich.
Wäre das so schlimm … oder … die Hoffnung stirbt zuletzt
Verbände, Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer sind sich einig: So wie der Referentenentwurf und nun die fast unveränderte Formulierungshilfe dazu aussehen, sind sie nicht geeignet, den Beruf des Berufsbetreuers attraktiver zu machen oder die Kostensteigerungen der letzten Jahre auszugleichen. Viele haben nach dem Entwurf nicht nur keine Einkommenssteigerung, sondern sogar ein Einkommensminus errechnet.
Vielleicht ist es ganz gut, wenn sich eine neue Bundesregierung der dringend notwendigen Reform der Betreuervergütung annimmt. Vielleicht nimmt sie dann die vielen Einwände und Verbesserungsvorschläge auf und schafft ein wirklich zukunftsfähiges Vergütungssystem.
Wer die Formulierungshilfe und die Synopse zur bestehenden Rechtslage einsehen möchte, findet diese auf den Seiten des Bundesministeriums der Justiz: https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2024_Neuregelung_Betreuerverguetung.html?nn=110490