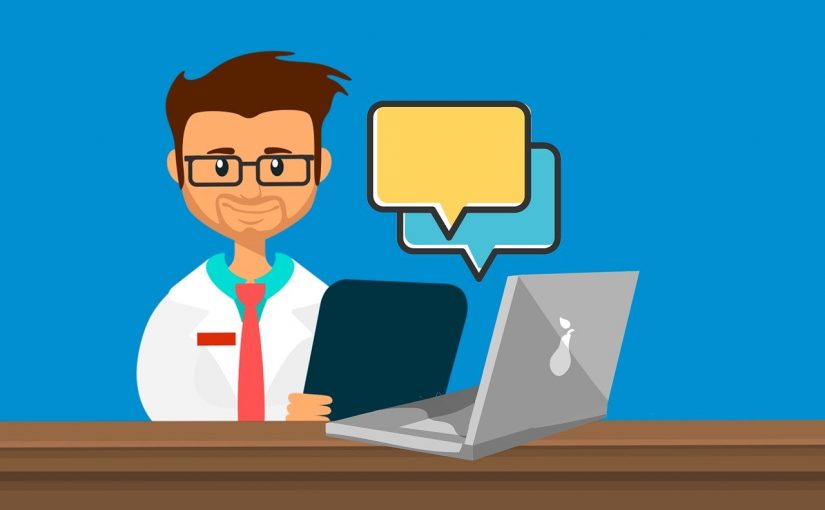Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und des 78. Jahrestages der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 wurde in diesem Jahr besonders der 500.000 ermordeten Sinti und Roma gedacht.
Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus
Im Mai 2019 wurde der Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus (Perspektivwechsel – Nachholende Gerechtigkeit – Partizipation) veröffentlicht, der am 31. März dem Bundestag zur Beschlussempfehlung erneut (erstmals im Juni 2021) vorgelegt werden sollte.
Die Abstimmung über den Bericht wurde nun schon wieder kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestages am Freitag, 31. März 2023, abgesetzt.
Beauftragter gegen Antiziganismus
In dem mehr als 800 Seiten umfassenden Bericht fordert die 2019 eingesetzte Kommission die Bundesregierung auf, einen „Beauftragten gegen Antiziganismus“zu berufen, der Maßnahmen zur Überwindung von Antiziganismus koordinieren soll. Beraten werden soll er nach dem Willen der Kommission von einem unabhängigen Kreis aus Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft, der von der Bundesregierung in Absprache mit dem Beauftragten berufen wird.
Zur Sicherstellung der Umsetzung zahlreicher in dem Bericht formulierten Empfehlungen fordert die Kommission zudem die Schaffung einer ständigen Bund-Länder-Kommission, da viele Maßnahmen zur Überwindung von Antiziganismus laut Vorlage in die Zuständigkeit der Länder fallen.
Anerkennung des Genozids an Sinti und Roma
Zu den zentralen Forderungen der Kommission zählt zudem die umfassende Anerkennung des nationalsozialistischen Genozids an Sinti und Roma. Für nicht in Deutschland lebende Überlebende des NS-Völkermordes an Sinti_ze und Rom_nja fordert die Kommission die Einrichtung eines Sonderfonds durch das Bundesfinanzministerium für diejenigen, die nach den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik bisher keine oder nur geringfügige Entschädigungen erhalten haben.
Eine niedrigschwellige, einmalige Anerkennungsleistung sei für alle Roma und Sinti vorzusehen, die vor der Befreiung ihres damaligen Heimat- oder Emigrationslandes von der NS-Besatzung oder den mit dem NS-Regime kollaborierenden Regierungen geboren wurden, heißt es in der Vorlage weiter. Wer die Anspruchsvoraussetzungen erfülle, solle laufende Leistungen erhalten.
Aniziganismus in Deutschland
Der Bericht listet zu Beginn eine Reihe erschreckender Ereignisse auf, die während der Erstellung des Berichts seit 2019 in Deutschland passierten und die zeigen, dass Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja hierzulande coh weit verbreitet ist.
Dazu gehören:
- die gesetzwidrige Sondererfassung von Sinti_ze und Rom_nja bei der Berliner Polizei,
- antiziganistisch legitimierten Absperrungen ganzer Wohnblocks im Kontext der Corona-Ausnahmesituation,
- Planungen zu einem Abbau des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas aufgrund des Baus einer S-Bahn-Trasse,
- Abschiebungen von seit Jahrzehnten in Deutschland lebenden Rom_nja in existenziellen Notlagen,
- Abführung eines elfjährigen Kindes in Handschellen und seine Inhaftnahme,
- Äußerungen von prominenten Personen aus der Unterhaltungsbranche, die in ignoranter, verletzender und verächtlichmachender Manier bei mehreren Anlässen vor einem Millionenpublikum ihr Beharren auf der rassistischen Fremdbezeichnung „Zigeuner“ zum Besten gaben,
- der rechtsterroristische Anschlag in Hanau vom 19. Februar 2020. Unter den neun Todesopfern befinden sich drei Angehörige aus den Communitys von Sinti_ze und Rom_nja: die 35-jährige Mercedes Kierpacz, der 23-jährige Vili Viorel Păun und der 33-jährige Kaloyan Velkov.
Schaden umfassend ausgleichen
Die Kommission fordert darüber hinaus, „den gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Schaden, der durch die massive Benachteiligung in der Wiedergutmachungspraxis und den fortgesetzten Antiziganismus nach 1945 der Zweiten Generation entstanden ist, umfassend auszugleichen“. Den bis 1965 in Deutschland geborenen Kindern der im Nationalsozialismus verfolgten Sinti und Roma seien daher nach dem Vorbild der „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ einmalige Pauschalen auszuzahlen.
Des Weiteren dringt das Gremium auf die Einsetzung einer Kommission zur Aufarbeitung des an Sinti und Roma begangenen Unrechts in der Bundesrepublik. Sinti und Roma „wurde und wird durch staatliche Behörden und andere gesellschaftliche Institutionen der Bundesrepublik Deutschland (zum Beispiel Polizei, Justiz, öffentliche Verwaltung, Ausländer- und Sozialbehörden, Schulen, Jugendämter, Kirchen, Wohlfahrtsverbände) gravierendes Unrecht zugefügt“, schreiben die Autoren. Deshalb fordere die Kommission die Bundesregierung auf, einen „umfassenden Prozess der Aufarbeitung dieses auch als Zweite Verfolgung bezeichneten Unrechts einzuleiten“. Dazu solle die Bundesregierung ein mit angemessenen finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattetes Gremium einsetzen.
Anerkennung geflüchteter Roma als schutzwürdig
Ferner pocht die Kommission in ihrem Bericht auf die Anerkennung geflüchteter Roma als „besonders schutzwürdige Gruppe“. Mit Blick auf die praktische Anwendung der Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes sei klarzustellen, dass die in Deutschland lebenden Roma „aus historischen und humanitären Gründen als eine besonders schutzwürdige Gruppe anzuerkennen sind“. Landesregierungen und Ausländerbehörden seien aufgefordert, die Praxis der Abschiebung von Roma sofort zu beenden. Der Bundesregierung und dem Bundesgesetzgeber wird in dem Bericht empfohlen, die Einstufung von Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Montenegro und dem Kosovo als asylrechtlich „sichere Herkunftsstaaten“ zurückzunehmen.
Zentrale Forderungen
Schließlich macht sich die Kommission in ihren „zentralen Forderungen“ für die „Umsetzung und Verstetigung von Partizipationsstrukturen“ stark. Unter anderem soll danach die zivilgesellschaftliche Arbeit der Organisationen von Sinti und Roma in Deutschland durch „transparente Strukturen einer dauerhaften finanziellen Förderung“ gestärkt werden.
Quellen: Bundestag
Abbildung: pixabay.com racism-5271245_1280