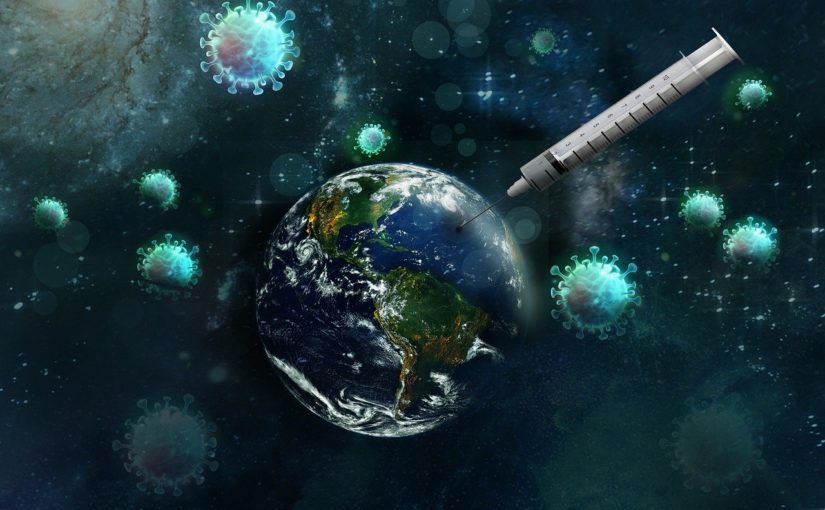Der Bundestag berät am Donnerstag, 4. März 2021, abschließend über den von CDU/CSU und SPD vorgelegten Gesetzentwurf „zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen“ (19/26545).
Mit diesem Gesetz sollen die Sonderregelungen im Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI, Pflegeversicherung) zugunsten von Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen, zugelassenen Pflegeeinrichtungen und Angeboten zur Unterstützung im Alltag um weitere drei Monate verlängert werden.
Das betrifft folgende Regelungen:
Qualitätsprüfungen
§ 114 SGB XI
Die gesetzliche Pflicht der Pflegekassen, in jeder Pflegeeinrichtung zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 31. Dezember 2021 eine Prüfung durchführen zu lassen (Absatz 2 Satz 2 alte Fassung), wird mit der Neuregelung in Absatz 2a entsprechend der anhaltenden SARS-CoV-2-Pandemie zugunsten einer flexibleren Handhabung modifiziert. Mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz vom 27. März 2020 wurden die Qualitätsprüfungen ausgesetzt. Seit dem 1. Oktober 2020 sollen Qualitätsprüfungen wieder regulär stattfinden.
Die Pflicht, jede Einrichtung im Jahr 2021 einmal zu prüfen, wird grundsätzlich aufrechterhalten, dem pandemischen Geschehen soll aber flexibel Rechnung getragen werden. Die Spitzenverbände der Kassen und der Medizinische Dienst bestimmen auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und mit dem Ziel, die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu unterstützen, verbindlich das Nähere zur Durchführbarkeit von Qualitätsprüfungen und passen die Regelungen gegebenenfalls an.
Die Gemeinschaft der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung hat ein Hygienekonzept herausgegeben, das Empfehlungen für die Durchführung der Qualitätsprüfungen in der Pandemie abgibt. Die gesetzlich geforderten Konkretisierungen durch den Spitzenverband Bund der Pflegekassen könnten zum Beispiel auf dieses Hygienekonzept sowie auf bereits durchgeführte Impfungen Bezug nehmen. Die Lockerung der Prüfpflicht gilt bis Ende 2021.
Pflegegutachten
§ 147 SGB XI
Abweichend von § 18 Absatz 2 Satz 1 können nach § 147 Absatz 1 Gutachten aufgrund der zur Verfügung stehenden Unterlagen erstellt werden. Dies gilt für Anträge auf Pflegeleistungen, die zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 31. März 2021 gestellt werden. Zugleich werden die antragstellende Person und andere zur Auskunft fähige Personen von den Gutachterinnen und Gutachtern zur Person des Antragstellers in strukturierten Interviews telefonisch oder auf digitalem Weg befragt. § 147 Absatz 1 setzt voraus, dass eine Begutachtung ohne Untersuchung des Versicherten in seinem Wohnbereich zur Verhinderung des Risikos einer Ansteckung des Versicherten oder des Gutachters mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zwingend erforderlich ist (bei Lockdown gegeben). Die Feststellung, wann eine Untersuchung im Wohnbereich des Versicherten unterbleibt, treffen der Medizinische
Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachterinnen und Gutachter aufgrund der entwickelten Maßgaben nach § 147 Absatz 1 Satz 3.
Aufgrund der Pandemielage ist eine Verlängerung der Möglichkeit einer Begutachtung ohne persönliche Untersuchung auch für Anträge auf Pflegeleistungen, die zwischen dem 1. April 2021 und dem 30. Juni 2021 gestellt werden, angezeigt.
Beratung
§ 148 SGB XI
Wenn Pflegebedürftige angesichts der erneut außerordentlich dynamischen Entwicklung der COVID-19-Pandemie lieber keinen fremden Menschen in ihrer Wohnung haben möchten, um sich insbesondere keinem zusätzlichen Infektionsrisiko auszusetzen, haben sie die Möglichkeit den Beratungsbesuch telefonisch, digital oder mittels Einsatz von Videotechnik abzurufen. Im Hinblick auf die außerordentlich dynamische Entwicklung des Pandemiegeschehens in den vergangenen Wochen und Monaten besteht die Notwendigkeit, diese Regelung bis zum Juni 2021 zu verlängern.
Versorgungsengpass
§ 150 Abs. 5
Pflegekassen können nach ihrem Ermessen zur Vermeidung von im Einzelfall im häuslichen Bereich verursachten pflegerischen Versorgungsengpässen, wenn vorrangige Maßnahmen nicht ausreichend sind, Kostenerstattung in Höhe der ambulanten Sachleistungsbeträge gewähren. Etwa, wenn kein ambulanter Pflegedienst eingesetzt werden kann. Die Regelung bleibt bis 30. Juni 2021.
Entlastungsbetrag
§ 150 Absätze 5b und 5c
Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1, die zu Hause leben, haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich (§ 45b SGB XI). Der Einsatz dieses Betrages ist eingeschränkt auf Maßnahmen von in den einzelnen Bundesländern zugelassenen Diensten. Bis zum 30.06.2021 haben Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 nun die Möglichkeit, den Entlastungsbetrag auch abweichend vom geltenden Landesrecht für andere Hilfen bzw. andere – professionelle und nicht professionelle – Anbieter zu verwenden (z. B. durch Nachbarn). Voraussetzung ist, dass die Hilfe erforderlich ist, um coronabedingte Versorgungsengpässe zu überwinden.
Die Übertragbarkeit der nicht verbrauchten Leistungsbeträge aus den Jahren 2019 und 2020 wird bis zum 30. September 2021 verlängert.
Vor dem Hintergrund der Umsetzung der Coronavirus-Testverordnung und der Impfstrategie ab dem Frühjahr 2021 wird mit einer sukzessiven Verbesserung der Leistungserbringung für zugelassene ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sowie für nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag gerechnet. Es ist somit davon auszugehen, dass es sich für die angesparten Leistungsbeträge aus dem Jahr 2019 um die letzte Verlängerung der Übertragbarkeit handelt. Ebenso ist im Hinblick auf die angesparten Leistungsbeträge aus dem Jahr 2020 nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass auch sie keiner weiteren Verlängerung über den 30. September 2021 hinaus bedürfen.
Pflegezeitgesetz
§ 9 Pflegezeitgesetz
Das Recht, der Arbeit zur Bewältigung einer pandemiebedingten akuten Pflegesituation bis zu 20 Arbeitstage fernzubleiben, bleibt bis zum 30. Juni 2021 bestehen.
Anspruchsdauer auf Pflegeunterstützungsgeld bzw. Betriebshilfe von 20 Arbeitstagen je Pflegebedürftigem. Keine Anrechnung von davor bereits beanspruchten Tagen Pflegeunterstützungsgeld auf die o. g. 20 Arbeitstage, ebenfalls bis 30. Juni.
Beschäftigte haben weiterhin das Recht, aufgrund der aktuellen Pandemie mit Zustimmung des Arbeitgebers Familienpflegezeit nach einer Pflegezeit in Anspruch zu nehmen, ohne dass die Freistellungen unmittelbar aneinander anschließen müssen. Die Familienpflegezeit muss spätestens mit Ablauf des 30. Juni 2021 enden. Gleiches gilt auch für die Inanspruchnahme einer Pflegezeit oder Freistellung nach § 3 Absatz 5 nach einer Familienpflegezeit. Die Pflegezeit muss spätestens mit Ablauf des 30. Juni 2021 enden.
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Pflegezeit für die Pflege oder Betreuung desselben nahen Angehörigen, auch wenn eine bereits in Anspruch genommene Pflegezeit beendet ist, wird verlängert. Damit haben Beschäftigte weiterhin die Möglichkeit, bislang nicht genutzte Monate in Anspruch zu nehmen, wenn sich Pflegearrangements aufgrund der Pandemie ändern. Die Pflegezeit muss spätestens mit Ablauf des 30. Juni 2021 beendet sein.
Familienpflegezeitgesetz
§ 3 Familienpflegezeitgesetz
Aufgrund des sich fortsetzenden Infektionsgeschehens und der andauernden SARS-CoV-2-Pandemie werden auf Antrag im Zeitraum vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2021 auch weiterhin Kalendermonate bei der Berechnung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts durch das Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben außer Betracht gelassen, in denen das Einkommen, zum Beispiel infolge von Kurzarbeit, abgesenkt war. Der Zusammenhang des geringeren Arbeitsentgelts mit der SARS-CoV-2-Pandemie wird weiterhin vermutet.
§ 16 Familienpflegezeitgesetz
Verlängert wird die Regelung in Absatz 3, wonach die oder der Beschäftigte das Recht hat, mit Zustimmung des Arbeitgebers Familienpflegezeit nach einer beendeten Pflegezeit in Anspruch zu nehmen, ohne dass die Freistellungen unmittelbar aneinander anschließen müssen. Die Familienpflegezeit kann längstens bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 in Anspruch genommen werden. Gleiches gilt auch für die Inanspruchnahme der Pflegezeit oder Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes nach einer Familienpflegezeit gemäß Absatz 4. Auch hier muss die Pflegezeit spätestens mit Ablauf des 30. Juni 2021 enden.
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Familienpflegezeit für die Pflege oder Betreuung desselben nahen Angehörigen, auch wenn eine bereits in Anspruch genommene Familienpflegezeit beendet ist, wird verlängert.
Die Familienpflegezeit muss spätestens mit Ablauf des 30. Juni 2021 beendet sein.
Quellen: Bundestag
Abbildung: pixabay.com old-people-3688950_1280.jpg