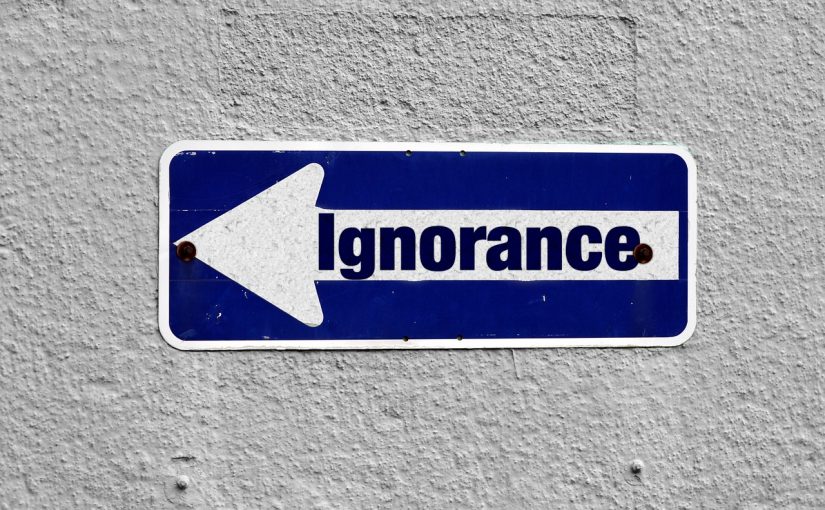Zur Zeit legt dem EU-Rat der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vor.
Maßnahmen
Mit diesem Vorschlag sollen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt in der EU wirksam bekämpft werden. Zu diesem Zweck werden darin Maßnahmen in den folgenden Bereichen vorgeschlagen:
- Strafbarkeit von und
- Strafen für einschlägige Straftaten,
- Schutz der Opfer und Zugang zur Justiz,
- Unterstützung der Opfer,
- Verhütung,
- Koordinierung und Zusammenarbeit.
geschlechtsspezifische Gewalt
Gewalt gegen Frauen ist geschlechtsspezifische Gewalt, die gegen eine Frau gerichtet ist, weil sie eine Frau ist, oder die Frauen unverhältnismäßig stark trifft. Sie umfasst jede gegenüber Frauen aufgrund ihres Geschlechts vorgenommene Gewalttat, die bei ihnen einen körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schaden oder Leidensdruck verursacht oder zu verursachen droht, einschließlich der Androhung solcher Handlungen.
Sie umfasst Straftaten wie
- sexuelle Gewalt, einschließlich Vergewaltigung,
- weibliche Genitalverstümmelung,
- Zwangsehen,
- Zwangsabtreibung oder Zwangssterilisation,
- Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung,
- Stalking,
- sexuelle Belästigung,
- Femizid,
- Hassreden und Straftaten aufgrund des Geschlechts sowie
- verschiedene Formen der Online-Gewalt (im Folgenden „Cybergewalt“), einschließlich der Weitergabe oder der Manipulation von intimen Materialien ohne Zustimmung, Cyberstalking und Cybermobbing.
Wurzeln der Gewalt
Diese Gewalt hat ihre Wurzeln in der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und ist Ausdruck der strukturellen Diskriminierung von Frauen. Häusliche Gewalt ist eine Form der Gewalt gegen Frauen, da Frauen unverhältnismäßig stark davon betroffen sind. Sie findet innerhalb der Familie oder des Haushalts statt, unabhängig von biologischen oder rechtlichen familiären Bindungen, entweder zwischen Intimpartnern oder zwischen anderen Familienmitgliedern, einschließlich zwischen Eltern und Kindern. Frauen sind aufgrund der zugrunde liegenden Muster von Nötigung, Macht und/oder Kontrolle als Opfer beider Formen von Gewalt überdurchschnittlich stark betroffen. Allerdings kann jede Person unabhängig vom biologischen oder sozialen Geschlecht ein potenzielles Opfer solcher Gewalt sein. Insbesondere von häuslicher Gewalt kann jede Person betroffen sein, auch Männer, jüngere oder ältere Menschen, Kinder und LGBTIQ-Personen.
Ziel ist die Verhütung von Gewalt
Ziel dieses Vorschlags ist es, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten und zu bekämpfen, um ein hohes Maß an Sicherheit und die uneingeschränkte Wahrnehmung der Grundrechte in der Union, einschließlich des Rechts auf Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung von Frauen und Männern, zu gewährleisten. Der Vorschlag trägt somit zur Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Titel V AEUV) bei. Um diese Ziele zu erreichen, ist im Vorschlag Folgendes vorgesehen:
- ·wirksamere Gestaltung der bestehenden Rechtsinstrumente der EU, die für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt relevant sind,
- ·Aufwärtskonvergenz und Schließung der Lücken in den Bereichen Schutz, Zugang zur Justiz, Unterstützung, Verhütung sowie Koordinierung und Zusammenarbeit, und
- ·Angleichung des EU-Rechts an einschlägige internationale Normen.
Blockade einiger EU-Staaten
Insbesondere Deutschland und Frankreich blockieren allerdings den Richtlinien-Vorschlag. Das deutsche Justizministerium glaubt nicht, dass der Vorschlag der Kommission mit dem Europarecht vereinbar wäre. Die EU überschreite mit dem Artikel zu Vergewaltigungen ihre Regelungskompetenz, so das Argument. Da sich Mitgliedstaaten, EU-Parlament und Kommission bisher nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen konnten, droht die gesamte Richtlinie zu scheitern.
Offener Brief an den Justizminister
In einem offenen Brief appellieren über 100 namhafte Frauen aus Politik, Kultur und Wirtschaft an Justizminister Marco Buschmann (FDP) und die Bundesregierung, von ihrem Widerstand gegen eine EU-Richtlinie zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt abzurücken.
2.300 Opfer pro Jahr in Europa
In dem Schreiben heißt es, mit dieser EU-Richtlinie habe es noch nie einen besseren Schutz von Frauen vor männlicher Gewalt gegeben. Die Situation verlange es aber, denn sie sei tragisch: „Jeden Tag werden zwischen 6 und 7 Frauen in Europa von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das sind 2.300 tote Frauen jedes Jahr – und das ist nur die offizielle Schätzung der UN. Jedes Jahr werden ca. 1,5 Millionen Frauen laut einer Schätzung auf Basis von EU-Daten vergewaltigt. Im Schnitt hat in der EU schon jede zweite Frau sexuelle Belästigung und jede dritte Frau sexualisierte oder körperliche Gewalt erfahren.“
Hauptstreitpunkt
Doch Hauptstreitpunkt in den Verhandlungen zwischen Europäischen Parlament und dem Rat ist die Harmonisierung des Vergewaltigungsstraftatbestands. Endlich soll EU-weit auf den Willen der Personen entscheidend abgestellt werden. Das ist wichtig, denn 11 EU-Mitgliedsstaaten verwenden immer noch Definitionen von Vergewaltigung, die Gewaltanwendung oder Drohung als entscheidendes Unrechtsmerkmal markieren: Bulgarien, Tschechien, Estland, Frankreich, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die Slowakei, d.h., dass ein einfaches “Nein” des Opfers in diesen Fällen nicht ausreicht, um den Tatbestand zu erfüllen. Diese Gesetzgebung bietet dadurch nicht ausreichenden Schutz für Opfer, da sie typische Fälle von Vergewaltigungen, insbesondere in Nähebeziehungen wie Partnerschaften, nicht erfasst.
Glaubwürdigkeit nicht verspielen
Deutschland müsse die Blockade-Haltung aufgeben, appelieren die Frauen an die Bundesregierung und insbesondere an Justizminister Buschmann, und sich klar positionieren, denn auch auf internationaler Ebene verspiele Deutschland sonst jede Glaubwürdigkeit und verliere an Verhandlungsmacht: Wenn ein Zugeständnis auf EU-Ebene Frauenrechte adäquat zu schützen ausbleibe, könne Deutschland sich nicht international als Vorreiter und Verfechter für diese Rechte positionieren. Eine Zustimmung zu einer umfassenden EU-Richtlinie hätte somit eine bedeutende Signalwirkung auch an andere Länder.
Quellen: EUR-Lex, Center for Feminist Foreign Policy (CFFP), Spiegel, Tagesschau
Abbildung: pixabax.com fist-1131143_1280.jpg