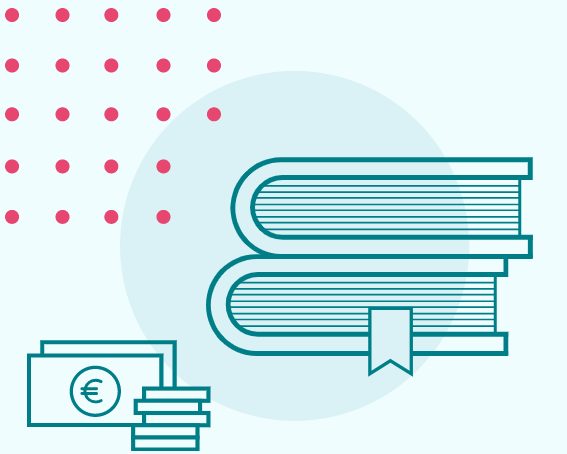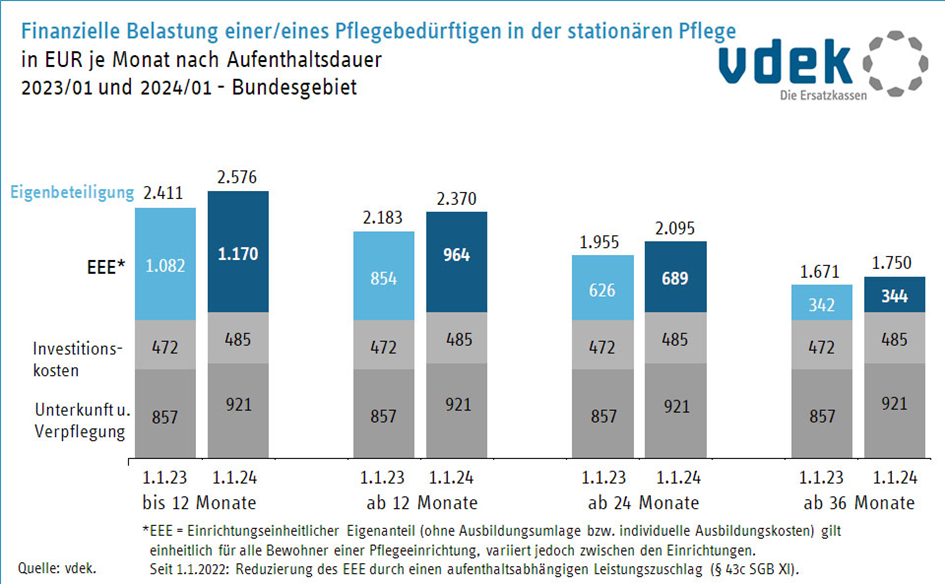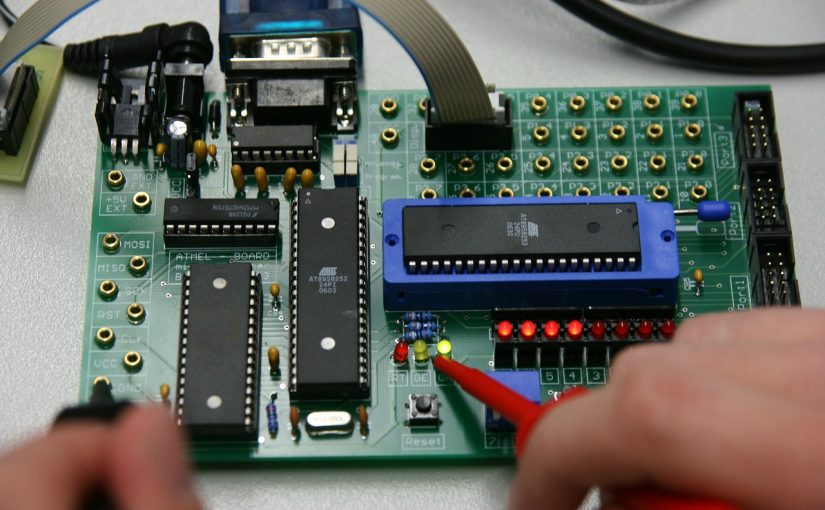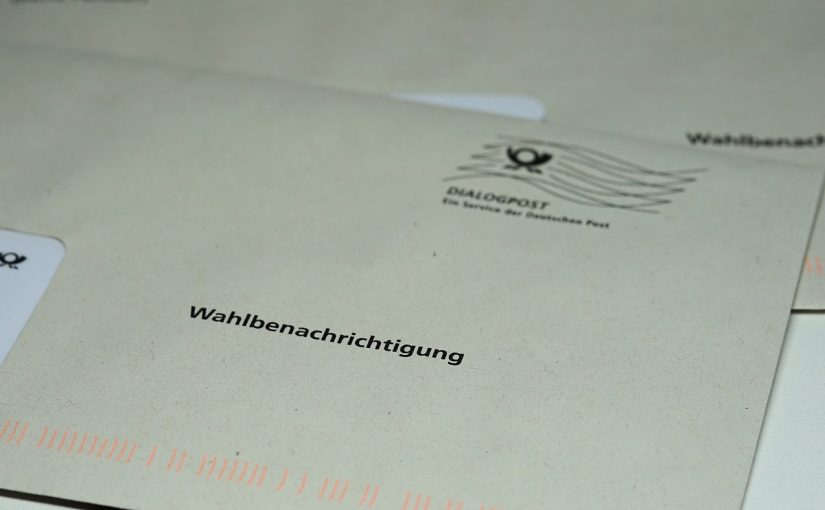Das ist das Fazit von Dr. Irene Becker in ihrer Expertise im Auftrag des Paritätischen Gesamtverbandes über die Entwicklung der Kaufkraft in der Grundsicherung. Die zentrale Aussage ist: „Bürgergeld: Erhöhungen gleichen Kaufkraftverluste in früheren Jahren nicht aus“.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- In den drei Jahren 2021 bis Ende 2023 haben die Leistungsbeziehenden in der Grundsicherung / Bürgergeld massive Kaufkraftverluste erlitten. Besonders gravierend waren die Kaufkraftverluste in den beiden Jahren 2022 und 2023 – auch bei Gegenrechnung der Einmalleistung 2022 und der Energiepreispauschale für Erwerbstätige und Rentner*innen. Trotz der Anpassung mit der Einführung des Bürgergelds um 11,7 % zum 1. Januar 2023 ergibt sich in der Gesamtbetrachtung des Jahres ein massiver Kaufkraftverlust. Zur Vermeidung eines Kaufkraftverlustes hätte der Regelbedarf für eine alleinstehende Person bereits im Januar 2023 bei 527 Euro statt 503 Euro liegen müssen.
Singlehaushalt
Die Kaufkraftverluste bewegen sich in der Gesamtsumme bei einem Singlehaushalt auf bis zu 1.012 Euro (diese Summe reduziert sich um 300 Euro Energiepreispauschale als Sonderzahlung im Jahr 2022, sofern Erwerbstätigkeit oder Rentenansprüche vorlagen, also auf 712 Euro).
Paarhaushalt
Bei einem Paarhaushalt mit zwei Kindern (über 14 Jahre) summiert sich der Kaufkraftverlust auf bis zu 3.444 Euro (Reduktion wiederum um 300 Euro, sofern Erwerbstätigkeit oder Rentenleistung vorlag; Annahme: nur ein Teil des Haushalts mit entsprechendem Anspruch, da zwei Erwerbstätige und / oder Rentner*innen in der Regel nicht hilfebedürftig sind). - Der Anstieg der Regelleistung für eine Erwachsene („Regelbedarfsstufe 1“) zum 1.1.2024 von 502 auf 563 Euro ist – entgegen der Darstellung einiger politischer Akteure – keine exorbitante Steigerung, sondern lediglich eine teilweise Kompensation der bisherigen Kaufkraftverluste und reicht nicht einmal aus, um etwa aufgelaufene Schulden zu begleichen. Für die Leistungsberechtigten ist die Anpassung gleichwohl eine wichtige und spürbare Erleichterung. Der reale Wert der Regelbedarfe übersteigt nunmehr geringfügig den Standard aus 2021.
- Mit der bestehenden Anpassungsformel im Gesetz droht zum Jahreswechsel 2025 eine Nullrunde bei der nächsten Anpassung und damit ein neuerlicher Kaufkraftverlust.
Forderungen
Der Paritätische leitet daraus folgende Forderungen ab:
- Der Regelbedarf muss endlich auf ein armutsfestes Niveau angehoben werden. Nach den jüngsten Berechnungen der Paritätischen Forschungsstelle wäre hierfür ein Regelbedarf von 813 Euro (2024) sachgerecht.
- Die Regelbedarfsanpassung in den Jahren zwischen der Neuermittlung der Regelbedarfe muss kurzfristig reformiert werden, damit eine neuerliche Entwertung der Leistungen vermieden werden kann. Dazu muss insbesondere die Anpassung zeitnäher organisiert und im Ergebnis ein Kaufkraftverlust vermieden werden.
Quelle: Paritätischer Gesamtverband
Abbildung: Fotolia_113739057_Subscription_XL.jpg