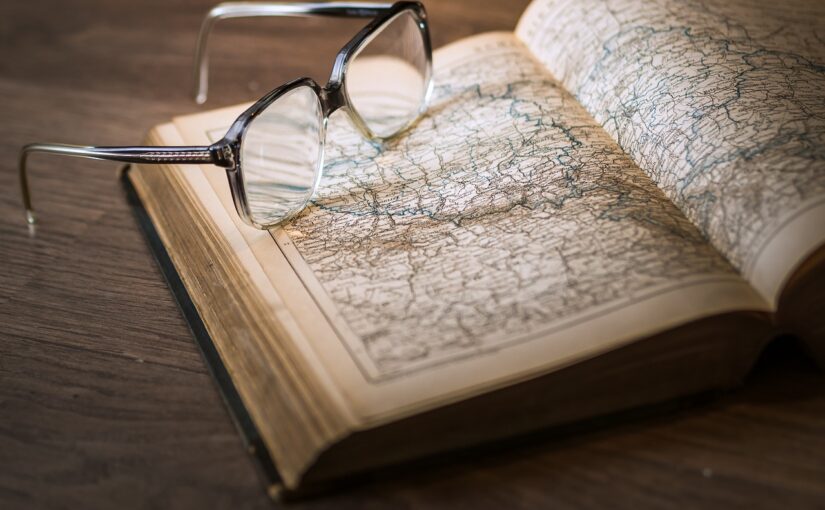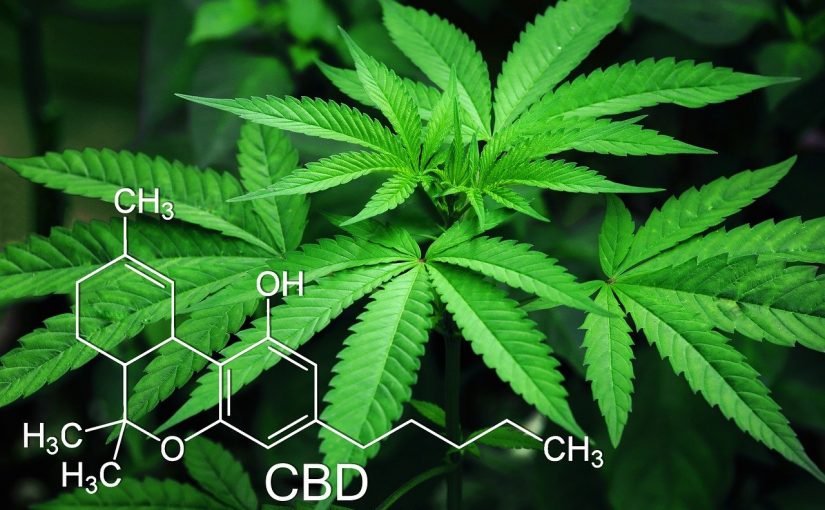Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, am 23. Mai 1949 in Kraft getreten, feiert seinen 75. Geburtstag. Ein Meilenstein der deutschen Geschichte, der die Werte von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verankert. Doch es gibt einen Schatten, der über diesem Jubiläum liegt: die fehlende explizite Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz.
Vergangene Anstrengungen zur Verankerung der Kinderrechte
Die Forderung nach einer Aufnahme der Kinderrechte in unsere Verfassung hat eine lange Vorgeschichte. Insbesondere seit der Ratifikation der UN-Kinderrechtskonvention durch die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1992 wird eine stete Diskussion um die mögliche Aufnahme spezifischer Kindergrundrechte in das Grundgesetz geführt. Auch die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte setzt sich seit ihrer Einrichtung 2015 für diese Grundgesetzerweiterung ein. Auch der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat wiederholt entsprechende Empfehlungen an Deutschland gerichtet.
Im Januar 2021 unternahm die damalige Bundesregierung einen erneuten Anlauf, indem sie einen Gesetzentwurf vorlegte, der die Kinderrechte in Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes verankern sollte. Trotz der Bemühungen scheiterte dieser Versuch an der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat.
Auch die aktuelle Regierung hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Kinderrechte i Grundgesetz zu verankern – zumindest ist dies dem Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode zu entnehmen. Auf Seite 77 ist dort zu lesen:
„Wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankern und orientieren uns dabei maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Dafür werden wir einen Gesetzesentwurf vorlegen und zugleich das Monitoring zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ausbauen.“
Geschehen ist das bisher nicht.
Warum die Aufnahme bisher scheiterte
Die Gründe für das Scheitern sind vielschichtig. Kritiker befürchten, dass eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz zu Widersprüchen und Überschneidungen mit bestehenden Artikeln führen könnte. Als Argument wird dabei angeführt, dass die allgemeinen Grundrechte des Grundgesetzes – etwa die Menschenwürde, das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder das Diskriminierungsverbot – auch Kindern zugutekämen und daher eine zusätzliche Verankerung der Kinderrechte nicht notwendig bzw. eben zu Überschneidungen führen könnte.
Insbesondere besteht auch die Sorge, dass eine explizite Verankerung der Kinderrechte das im Grundgesetz festgeschriebene Elternrecht einschränken könnte.
Was wären die Vorteile einer Verankerung?
Durch den Beitritt zur UN-Kinderrechtskonvention hat sich Deutschland dazu verpflichtet, die darin verankerten umfassende Rechte von Kindern und Jugendlichen umzusetzen. Die Konvention bietet einen umfassenden Rahmen für den Schutz von Kindern. Sie legt fest, dass Kinder das Recht auf Leben, Gesundheit, Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Diskriminierung haben. Sie betont auch die Bedeutung der Beteiligung von Kindern an Entscheidungen, die sie betreffen.
Allerdings sind die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention im deutschen Recht noch nicht vollständig verankert. Eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz würde diese Lücke schließen. Es würde unterstreichen, dass Deutschland die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern anerkennt und ihre Interessen zum Maßstab des Handelns macht.
Eine explizite Verankerung im Grundgesetz würde
- den Schutz von Kindern stärken und sie als eigenständige Rechtssubjekte anerkennen,
- die Rechtsdurchsetzung im Bereich des Kinderschutzes verbessern, da Gerichte und Behörden sich explizit an den Kinderrechten orientieren müssten,
- die Beteiligung von Kindern an Entscheidungen, die sie betreffen, fördern.
Zudem hätte die Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz eine starke Signalwirkung an die gesamte Gesellschaft, dass Kinderrechte ernst genommen werden.
Vor allem aber wäre es ein Geschenk an die junge Generation und zugleich ein Ausdruck unseres Selbstverständnisses als moderner, kinderfreundlicher Rechtsstaat.
Quellen: BMFSJ, Deutsches Institut für Menschenrechte, Wissenschaftlicher Dienst Deutscher Bundestag
Abbildung: Adobe Stock, 216506289, Urheber: Azazello