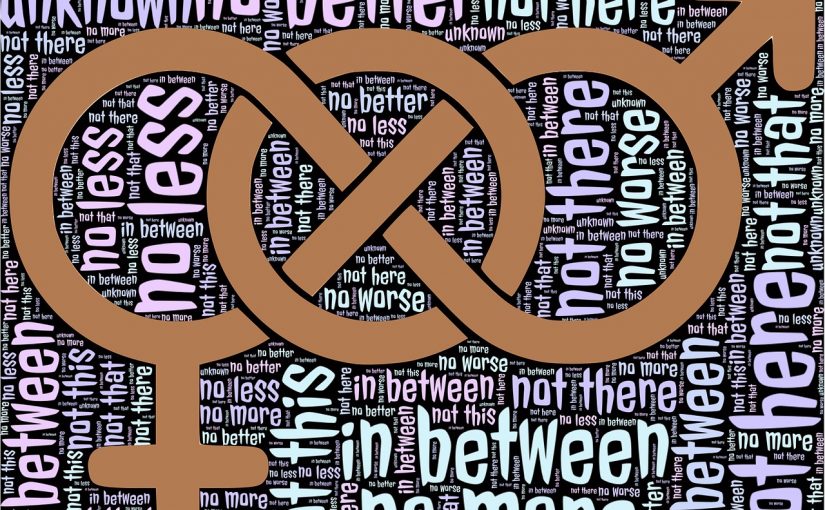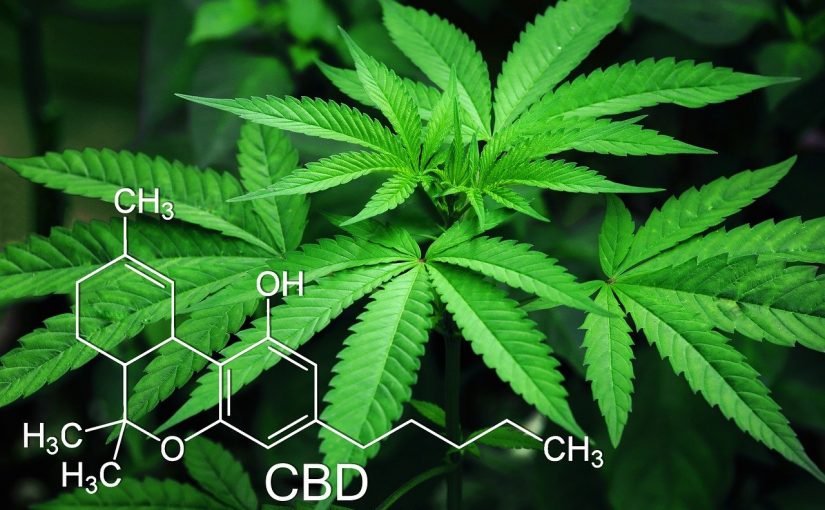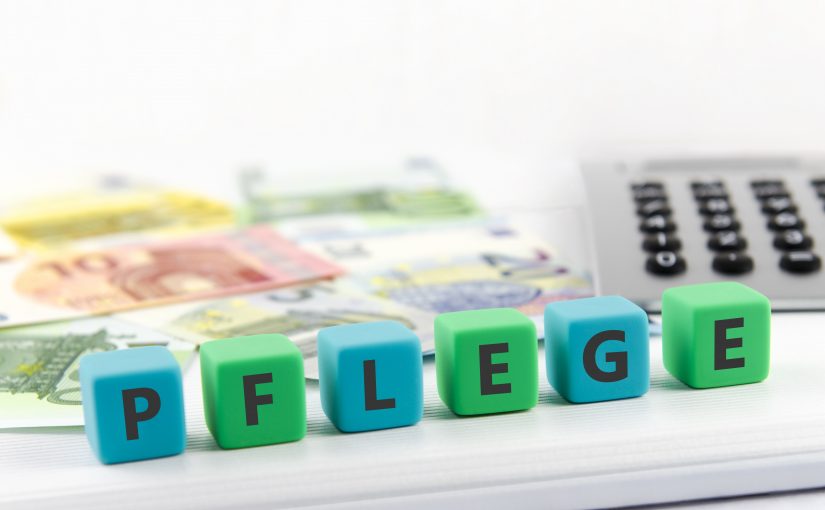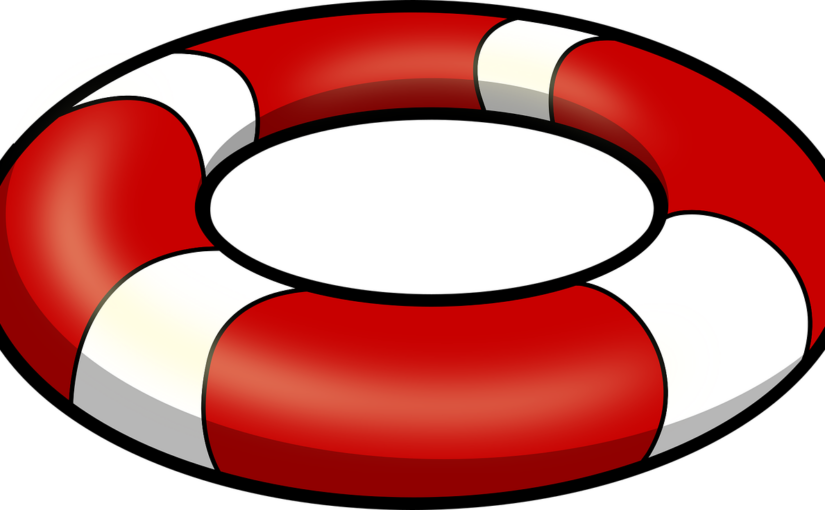Die Möglichkeiten der Medizin, auf gesundheitliche Defizite von Patienten zu reagieren, steigt stetig. Die Finanzierungsmöglichkeiten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind begrenzt. Aus diesem Grund ist der Gesetzgeber als „Hüter der gesetzlichen Krankenversicherung“ gezwungen, zu entscheiden oder ein Gremium einzusetzen, das entscheidet, welche Maßnahmen in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung Eingang finden sollen und welche nicht. Für den Fall, dass medizinische Maßnahmen durch die gesetzliche Krankenversicherung finanziert werden, muss entschieden werden, unter welchen Indikationen dies der Fall sein soll.
G-BA entscheidet, was Kassenleistungen sind
Diese Entscheidungen trifft insbesondere der Gemeinsame Bundesausschuss. Gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB V soll der Gemeinsame Bundesausschuss Richtlinien über die Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden beschließen, die einerseits die ärztliche Versorgung sicherstellen und andererseits eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten gewährleisten. Dadurch wird zugleich der Umfang von der gesetzlichen Krankenversicherung gegenüber den Versicherten geschuldeten Leistungen verbindlich festgelegt. Auf diese Weise hat der Gesetzgeber die Entscheidung über die Anerkennung von Heilmethoden dem Gesetzgebungsverfahren entzogen. Nach der Konzeption des Gesetzes haben somit auch die Gerichte nicht darüber zu entscheiden, ob eine medizinische Behandlungsmethode anerkennungswürdig und im Einzelfall auch erfolgversprechend ist. Vielmehr ist allein entscheidend, welcher medizinische Standard allgemein anerkannt ist und ob die zu beurteilende Methode diesem medizinischen Standard entspricht.
Die richtige Heilmethode
Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist den Gerichten damit eine Zurückhaltung im Hinblick auf medizinisch-wissenschaftliche Auseinandersetzungen um die „richtige“ Heilmethode auferlegt. Dies geht auch aus § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB V hervor. Es ist Ausdruck der Neutralität des Staates, Methoden der besonderen Therapierichtungen nicht auszuschließen. Der Schwerpunkt der Prüfung wird damit auf den tatsächlichen Verbreitungsgrad verlagert, weil es nicht Sinn eines Gerichtsverfahrens sein kann, die Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft voranzutreiben oder in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen Position zu beziehen (vgl: Urteil des Bundessozialgerichts vom 16.9.1997, Az: 1 RK 28/95, dies noch einmal ausgeführt im Urteil des Sozialgerichts Leipzig vom 8.6.2006, Az.: S 8 KR 646/04).
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)
Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Maßnahmen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht gedeckt sind, aus medizinischer Sicht übertrieben oder gar unnütz sind. Medizinische Maßnahmen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht finanziert werden, können durchaus den Patienten nützlich sein. Diese Grenze ist sehr viel weiter gesteckt als der Kreis der Kassenleistungen.
Die so genannten individuellen Gesundheitsleistungen (kurz „IGeL“ genannt) sind genau in dem Bereich angesiedelt, wo die gesetzliche Krankenversicherung die Kostenübernahme für die medizinischen Maßnahmen versagt, aber aus medizinischer Sicht noch keineswegs die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen bestritten werden kann.
IGeL-Monitor
Seit 2012 bewertet der IGeL-Monitor Individuelle Gesundheitsleistungen beim Arzt (IGeL). Die Arbeit erfolgt nach wissenschaftlichen Standards. Initiator und Auftraggeber ist der Medizinische Dienst Bund. Inhaltlich unterstützt wird das Projekt durch externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das Projekt IGeL-Monitor ist dem Bereich Evidenzbasierte Medizin des Medizinischen Dienstes Bund zugeordnet. Aufgabe des IGeL-Monitors ist das Bereitstellen von Gesundheitsinformationen über IGeL, damit Versicherte in der ärztlichen Praxis eine informierte Entscheidung treffen können.
Ergebnisse 2023
In einer repräsentativen Befragung hat der IGeL-Monitor für seinen IGeL-Report 2023 knapp 6.000 Versicherte im Alter von 20 bis 69 Jahren befragt. Die Bekanntheit von IGeL ist unverändert groß: Fast 80 Prozent der Befragten gaben an, Selbstzahlerleistungen zu kennen. Nur gut jeder Vierte (28 Prozent) weiß, dass es verbindliche Regeln beim Verkauf von IGeL in der Praxis gibt. Dazu gehört, dass Patientinnen und Patienten über den wahrscheinlichen Nutzen und mögliche Risiken oder Schäden durch die Leistung aufzuklären sind. Über den Nutzen wurden 78 Prozent informiert, über mögliche Schäden nur 56 Prozent. Fast jeder Fünfte (18 Prozent) gibt sogar an, dass seine Behandlung mit einer Kassenleistung vom Kauf einer IGeL abhängig gemacht wird.
Top10
Die Top 10 der am meisten verkauften Selbstzahlerleistungen sind im Vergleich zum IGeL-Report 2020 nahezu unverändert: Ultraschalluntersuchungen der Eierstöcke und der Gebärmutter zur Krebsfrüherkennung sowie verschiedene Glaukom-Früherkennungsuntersuchungen, zusätzlicher Abstrich zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs, der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs, zusätzliche Hautkrebsscreenings, zusätzliche Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft, Ultraschall der Brust zur Krebsfrüherkennung und Untersuchungen des Blutbilds.
Mehr Schaden als Nutzen
Der Ultraschall zur Krebsfrüherkennung der Eierstöcke und der Gebärmutter wurde nach der Befragung am meisten verkauft. Die Leistung bewertet der IGeL-Monitor mit „negativ“ und „tendenziell negativ“. Denn bei dieser Untersuchung kann es häufig zu falsch-positiven Befunden und dadurch zu unnötigen weiteren Untersuchungen und Eingriffen kommen, die erheblich schaden können.
Nur zwei IGeL sind „tendenziell positiv“
Aber auch bei den anderen Selbstzahlerleistungen sind Zweifel angebracht. Das Wissenschaftsteam des IGeL-Monitors bewertet seit über zehn Jahren evidenzbasiert den Nutzen und Schaden von Individuellen Gesundheitsleistungen und bereitet die Informationen für die Versicherten laienverständlich auf. Ziel ist es, den Patientinnen und Patienten eine wissensbasierte Entscheidungshilfe anzubieten. Der IGeL-Monitor hat 55 IGeL bewertet – 53 Leistungen schließen mit „tendenziell negativ“, „negativ“ oder „unklar“ ab. Für den Nutzen gibt es meistens keine ausreichende Evidenz . Keine dieser Leistungen konnte mit „positiv“ bewertet werden, mit „tendenziell positiv“ schneiden lediglich 2 Selbstzahlerleistungen ab.
Quellen: IGel-Monitor, SOLEX, Wikipedia
Abbildung: pixabay.com hedgehog-156172_1280.png