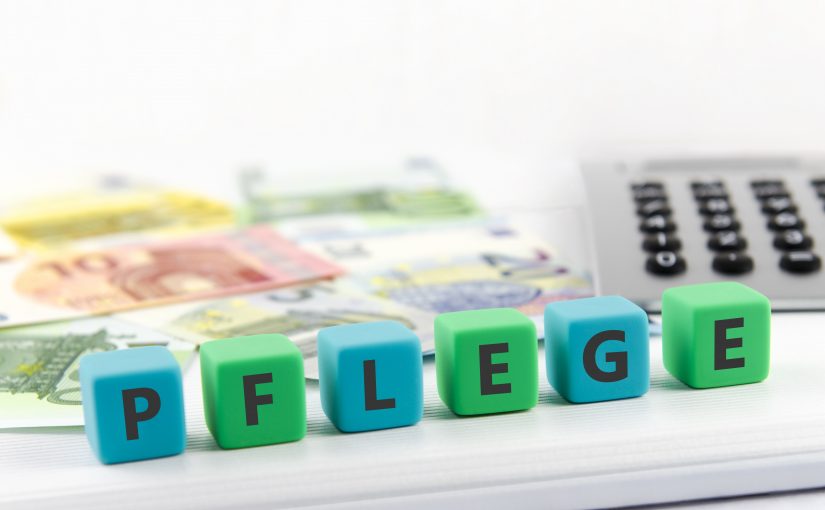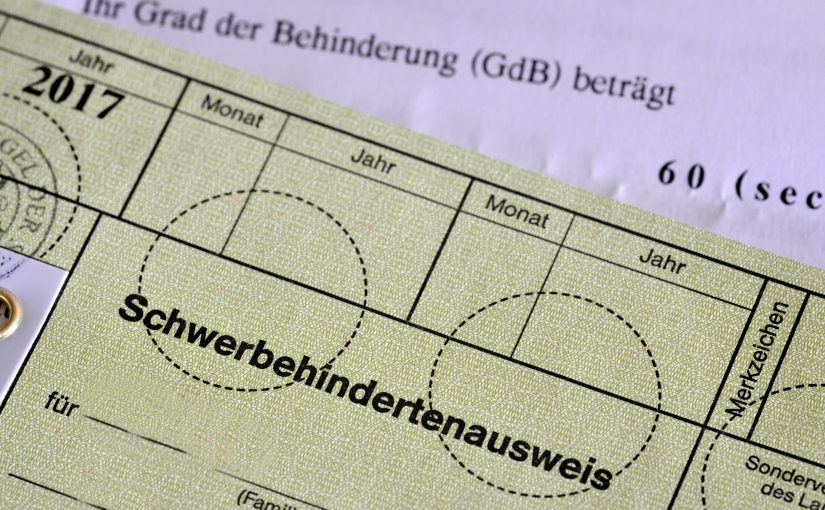Am 23. August 2023 verabschiedete das Bundeskabinett drei Gesetzesvorhaben:
- Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts,
- Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts,
- Entwurf eines Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag.
Namenssrecht
Der Gesetzentwurf sieht eine Modernisierung des bürgerlich-rechtlichen Namensrechts vor: also des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts. Das geltende deutsche Namensrecht ist sehr restriktiv, gerade auch im internationalen Vergleich. Es trägt der vielfältigen Lebenswirklichkeit und den Bedürfnissen vieler Familien nicht mehr hinreichend Rechnung. Kernstück der Reform ist die Einführung echter Doppelnamen für Ehepaare und Kinder. Wenn Ehen auseinandergehen, dann sollte das Recht Kinder nicht starrköpfig an einem Namen festhalten, der zu ihrer Lebenssituation nicht mehr passt. Und auch den Namenstraditionen von Minderheiten sollte das Recht mit Respekt begegnen. Mehr zu den Änderungsvorhaben beim Bundesjustizministerium.
Staatsbürgerschaft
Das Staatsangehörigkeitsrecht soll modernisiert werden. Zu dem Gesetzentwurf gab es an dieser Stelle im November 2022 und im Mai 2023 schon zwei Artikel. Den Kabinettsentwurf veröffentlicht das Bundesinnenministerium. Wesentliche Inalte des Entwurfs:
- Mehrstaatigkeit soll möglich werden: Zugewanderte müssen ihre bisherige Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung nicht mehr aufgeben.
- Einbürgerung soll beschleunigt werden: Statt nach 8 Jahren sollen Menschen bereits nach 5 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können.
- Besondere Leistung wird belohnt: Bei „besonderen Integrationsleistungen“ ist eine Einbürgerung bereits nach 3 Jahren möglich.
- Lebensleistung der Gastarbeitergeneration soll anerkannt werden: Nachweis mündlicher Sprachkenntnisse genügt für eine Einbürgerung (kein Einbürgerungstest notwendig)
Selbstbestimmung
Das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (Selbstbestimmungsgesetz, SBGG) möchte die durch das Grundgesetz garantierten Rechte
- freie Entfaltung der Persönlichkeit,
- Achtung der Privatsphäre und
- Nichtdiskriminierung
für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen sicherstellen. Dafür soll das veraltete und zum Teil verfassungswidrige Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980 aufgehoben und durch eine einheitliche Regelung ersetzt werden, mit der Menschen ihren Geschlechtseintrag oder ihre Vornamen per Selbstauskunft beim Standesamt ändern können.
Den Gesetzentwurf veröffentlicht das Bundesfamilienministerium. Seit 2020 berichten wir hier über die Bemühungen, die Diskriminierung des alten Transsexuellengesetzes zu überwinden:
- Juni 2020: Selbstbestimmungsgesetz – erster Gesetzentwurf der Grünen,
- Mai 2021: Kein Ende des Transsexuellengesetzes,
- Juni 2022: Selbstbestimmungsgesetz – Eckpunkte,
- Mai 2023: Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag,
- Mai 2023: LGBTIQ-Rechte weltweit
Kritik von Betroffenen
Betroffene erkennen an, dass mit dem Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung getan wurde, allerdings bemängeln sie, dass aus einem Gesetz zur selbstbestimmten Änderung staatlicher Anerkennung ein Gesetz geworden sei, das im Wesentlichen das tiefe Misstrauen gegenüber den verfassungsgemäßen Rechten geschlechtlicher Minderheiten regelt und rechtfertigt. Hier werde die bloße Existenz von TIN-Personen als Zumutung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft konstruiert und festgeschrieben. So beschreibt es das Online-Magazin Queer.de.
Quellen: Bundeskabinett, BMI, BMJ, BMFSFJ, Queer.de, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: Fotolia_144881072_Subscription_XL.jpg