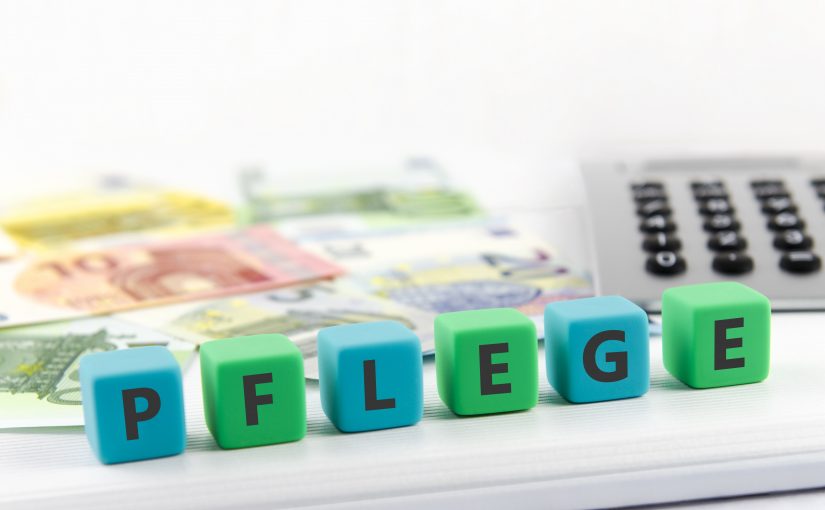Das Bundeskabinett hat den „Gesetzentwurf zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ auf den parlamentarischen Weg gebracht.
Hohe Zahl an Gewaltopfer
Kinder und Jugendliche vor allen Formen von Gewalt, insbesondere vor sexueller Gewalt und Ausbeutung zu schützen, zählt zu den grundlegenden Aufgaben des Staates und der Gesellschaft. Aus den in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2023 ersichtlichen Entwicklungen resultiert ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Denn die Daten der jährlichen PKS zu kindlichen Gewaltopfern weisen ein konstant hohes Niveau aus, das nicht hingenommen werden kann. Die PKS weist 3.443 Fälle von Kindesmisshandlung mit insgesamt 4.336 Opfern aus. Insbesondere aber die Fallzahlen des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind mit 16.375 Fällen (2022: 15.520) konstant hoch. Insgesamt weist die PKS hier 18.497 Opfer aus, 75,6 Prozent davon waren weiblich. 16.291 Opfer waren zwischen sechs und 14 Jahren alt, 2.206 betroffene Kinder waren jünger als sechs Jahre.
Große Dunkelziffer
Empirische Studien sowie Schätzungen der WHO (WHO 2013 „Europäischer Bericht über die Prävention von Kindesmisshandlung“) und des Europarates geben zudem berechtigte Hinweise darauf, dass das Dunkelfeld der nicht systematisch erfassten Fälle von allen Formen von Gewalt gegen Kinder um ein Vielfaches größer ist.
Ziele des Gesetzes
Der Gesetzentwurf verfolgt daher folgende Ziele:
- Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und Einführung einer forschungsbasierten Berichtspflicht,
- stärkere Beachtung der Belange von Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexuelle Gewalt oder Ausbeutung erfahren oder erfahren haben,
- Fortentwicklung von Aufarbeitungsprozessen in Deutschland und Sicherstellung beratender Unterstützung zur individuellen Aufarbeitung und
- die weitere Stärkung von Prävention und Qualitätsentwicklung im Kinderschutz.
Dieser Gesetzentwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ und trägt insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 16 bei, leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen und Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen von Gewalt gegen Kinder zu beenden.
Unabhängige Bundesbeauftragte
Den Hauptbestandteil des Gesetzentwurfes stellt die gesetzliche Verankerung der Struktur der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (Unabhängige Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bundesbeauftragter) selbst dar. Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte steht zum Bund in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Zu ihrer oder seiner Struktur gehören der Arbeitsstab der oder des Unabhängigen Beauftragten, ein dort angesiedelter Betroffenenrat, der die Einbeziehung der Belange von Betroffenen sicherstellt, und eine Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, die dem berechtigten Interesse der Betroffenen, aber auch der Notwendigkeit für Staat und Gesellschaft Rechnung trägt, Unrecht an Kindern und Jugendlichen individuell und institutionell aufzuarbeiten, es öffentlich zu benennen und die öffentliche Debatte hierüber versachlicht zu führen.
Berichtspflicht
Der Gesetzentwurf sieht zudem eine Berichtspflicht für die Unabhängige Bundesbeauftragte oder den Unabhängigen Bundesbeauftragten vor, die einen wiederkehrenden Lagebericht zum Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche (on- und offline) beinhaltet und die Identifizierung von Lücken und Bedarfen für wirkungsvolle Ansätze zur Prävention und Intervention und für Hilfen sowie zur Forschung und Aufarbeitung enthält.
Beratungsservice
Um Betroffene wirksam und verlässlich bei individuellen Aufarbeitungsprozessen zu unterstützen, wird der Bund ein Beratungssystem bereitstellen. Es wird ein Beratungsservice finanziert, der geeignet ist, die individuelle Aufarbeitung zu fördern und damit die Lebenssituation von Betroffenen zu verbessern. Betroffene werden dadurch auch darin unterstützt, Aufarbeitungsprozesse gegenüber dem sozialen Nahbereich oder der Institution, in der sie sexuelle Gewalt oder Ausbeutung erlitten haben, aktiv mitzugestalten.
Die Verbindlichkeit des staatlichen Auftrags zur allgemeinen Aufklärung, Sensibilisierung und Qualifizierung wird durch einen gesetzlichen Auftrag an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung konkretisiert. Denn für einen wirkungsvollen Schutz ist kindzentrierte Prävention, Aufklärung und Fortbildung von zentraler Bedeutung.
Schutzkonzepte
Der Gesetzentwurf beinhaltet darüber hinaus eine Erweiterung der verpflichtenden Anwendung von Schutzkonzepten. Eine verbindliche Qualitätsentwicklung und -sicherung zum Gewaltschutz soll nicht mehr nur auf Einrichtungen und Familienpflege beschränkt sein, sondern sich auf alle Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendhilfe beziehen. Um aus Fällen wie „Staufen“ und „Lügde“ zu lernen, werden Fallanalysen problematischer Kinderschutzverläufe ausdrücklich als Bestandteil der dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegenden Qualitätsentwicklung geregelt und durch die notwendigen datenschutzrechtlichen Regelungen flankiert. Betroffene bekommen ausdrücklich Zugang zu Akten bei den nach Landesrecht zuständigen Trägern der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe (in der Regel das Jugendamt), das ihnen hierzu auch Auskunft erteilt. Zudem stellt der nach Landesrecht zuständige Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe (in der Regel das Jugendamt) durch Vereinbarungen sicher, dass Betroffene auch bei Leistungserbringern Einsicht in die Akten und Auskünfte hierzu erhalten. Darüber hinaus wird dauerhaft ein telefonisches Beratungsangebot im medizinischen Kinderschutz verankert.
Quelle: BMFSFJ, Bundesregierung, UNRIC, wikipedia, WHO
Abbildung: pixabay.com fist-1131143_1280.jpg