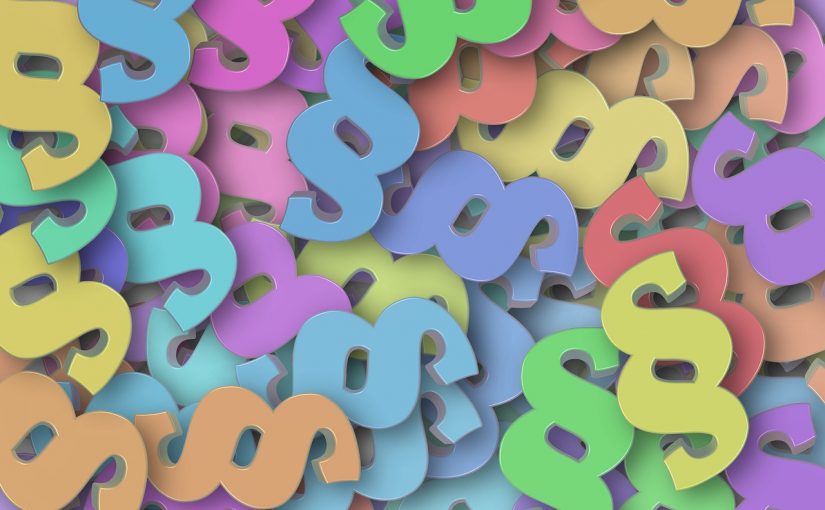Die von der Bundesregierung geplante neue Grundsicherung (21/3541), mit der viele Regelungen des Bürgergeldes abgeschafft werden sollen, war am 23.2.26 Gegenstand einer Anhörung von Experten im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Bundestags.
Flucht- oder Zuwanderungsbiografie
Jens Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales der Stadt Mannheim, begrüßte den Gesetzentwurf der Regierung grundsätzlich, ergänzte ihn aber durch den Vorschlag, Vermittlungsbemühungen der Jobcenter bereits vor der Bewilligung von Leistungen einzuleiten. Er erinnerte daran, dass rund 40 Prozent der Antragsteller eine Flucht- oder Zuwanderungsbiografie hätten. Diesem Umstand müsse besonders Rechnung getragen werden. Das sei durch möglichst dezentrale und lokal orientierte Vorgaben besser möglich als durch ein allzu „starres Regelwerk“.
Komplexe Probleme
Für die Bundesagentur für Arbeit begrüßte Regine Schmalhorst die erweiterten Möglichkeiten der Kooperation zwischen Antragsteller und Jobcenter. Das komme den „unterschiedlichen Bedürfnissen“ beider Seiten entgegen. Die Sachverständige wies auf die komplexen Probleme hin, mit denen sich die Arbeitsagenturen zu beschäftigen hätten – Sprachschwierigkeiten, Mietrechtsfragen, Arbeitsrechtsprobleme. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort können nicht in allen Bereichen der aufgerufenen Rechtsfragen Profis sein“, erklärte sie.
Kommunen vor dem Kollaps
Für den Deutschen Städtetag erklärte Nikolas Schelling, die Kommunen stünden wegen wachsender Sozialkosten „vor dem Kollaps“. Das Dilemma vieler Gemeinden sei, hohe Mittel zur Vermeidung von Obdachlosigkeit einsetzen zu müssen, während dann Geld für andere Aufgaben im Sozialbereich fehle. In manchen Ballungszentren und Großstädten belasteten die Verhältnisse auf dem Mietwohnungsmarkt alle Anstrengungen auf dem Feld der Sozialkosten, etwa bei den „Kosten der Unterkunft“.
Schutzmaßnahmen für vulnerable Gruppen fehlen
Martin Künkler vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) bewertete den Regierungsentwurf grundsätzlich „positiv“, weil er das Prinzip verfolge, „Arbeit zu finanzieren statt Arbeitslosigkeit“. Das komme schon dadurch zum Ausdruck, dass 600 Millionen Euro mehr für Vermittlung in Arbeit zur Verfügung stünden. Allerdings bezeichnete der DGB-Vertreter die vorgesehenen „Schutzmaßnahmen für vulnerable Gruppen“ (Kinder, psychisch Kranke) als „nicht ausreichend“. Hier sehe er dringenden Korrekturbedarf.
Veränderungen bei den Sanktionen
Katja Kipping vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband hielt Veränderungen bei den angedrohten Sanktionen für erforderlich. Schließlich betreffe jede dritte bisher verhängte Sanktion Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Daher reichten die Schutzvorkehrungen bei weitem nicht aus. Kipping schlug vor, eine persönliche Anhörung von Betroffenen vor Verhängung von Sanktionen als obligatorisch einzuführen. Zudem sei ein Problem, dass „viele psychisch Erkrankte ihre Probleme gegenüber den Jobcentern aus Scham verschweigen“.
Diese Regelungen gehören nicht ins 21. Jahrhundert
Der Bürgergeld-Aktivist Thomas Andreas Wasilewski urteilte: „Diese Regelungen gehören nicht ins 21. Jahrhundert.“ Bei Leistungskürzungen sei sehr schnell „der Kühlschrank leer“. Viele Arbeitslose bemühten sich um einen Job, aber es gebe davon einfach zu wenig. Außerdem sollten „Menschen das Recht haben, ein Arbeitsangebot abzulehnen“. Wenn manche Bürgergeldbezieher den Kontakt zu den Jobcentern abbrächen, liege das oft an der „Frustration nach zahlreichen erfolglosen Bewerbungen“, sagte Wasilewski.
Jede dritte Bedarfsgemeinschaft ist eine Familie mit minderjährigen Kindern
Unterdessen fordern Wohlfahrts- und Sozialverbände Korrekturen am Gesetzentwurf. In einem offenen Brief vom 19.2.26 an die Bundesregierung wenden sie sich vor allem gegen Verschärfungen zulasten von Familien und Kindern. Die Initiator:innen des Schreibens sind:
- Deutscher Juristinnenbund e. V. (djb)
- evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf)
- Liga für unbezahlte Arbeit e. V. (LUA)
- pro familia Bundesverband e. V.
- Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV)
- Zukunftsforum Familie e. V. (ZFF)
Unterzeichnet wurde das Schreiben von weiteren über 30 Organisationen, Vereinen und Verbänden aus der Kinderhilfe, Kirchen und Arbeitervereinen.
Quellen: Bundestag, Paritätischer Gesamtverband
Abbildung: pixabay,com geralt3.jpg