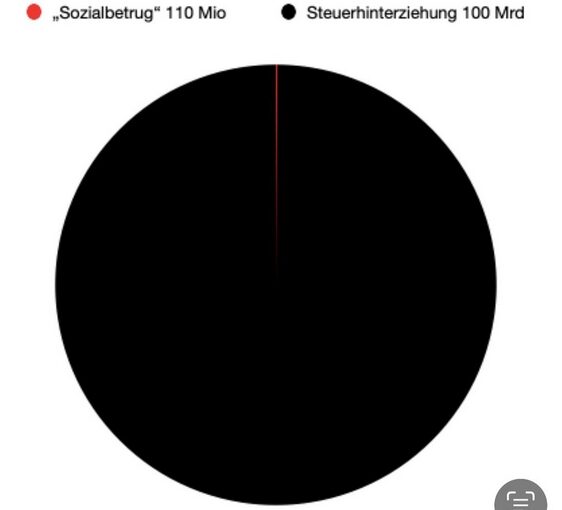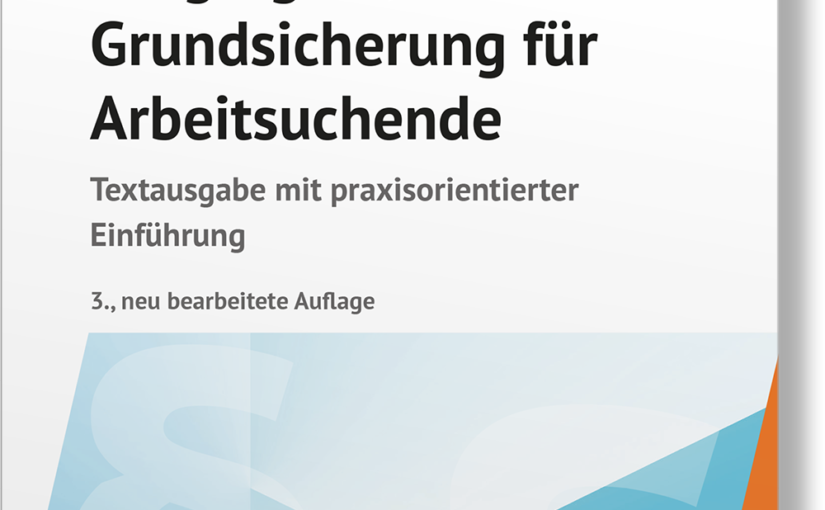Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem Beschluss vom 28. Oktober 2025 (Pressemitteilung Nr. 97/2025) mehrere Verfassungsbeschwerden von ausländischen Staatsangehörigen erfolgreich beschieden, die sich gegen ihre Festnahme vor der Anordnung einer Abschiebungshaft richteten.
Verletzung des Grundrechts auf Freiheit
Das Gericht stellte fest, dass die Beschwerdeführer in ihrem Grundrecht auf persönliche Freiheit aus Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) verletzt wurden. Dieses Grundrecht garantiert, dass die Festnahme einer Person nur aufgrund einer richterlichen Anordnung oder einer gesetzlich normierten Ermächtigungsgrundlage erfolgen darf.
Das BVerfG bemängelte, dass für die erfolgte Freiheitsentziehung, welche der richterlich angeordneten Abschiebungshaft unmittelbar vorausging, eine tragfähige gesetzliche Grundlage in Form eines förmlichen Gesetzes fehlte. Die zuständigen Behörden hatten sich bei den Festnahmen unter anderem auf Vorschriften der EU-Aufnahmerichtlinie und der Rückführungsrichtlinie berufen.
Unmittelbare Wirkung von EU-Richtlinien
Hierzu stellte das Bundesverfassungsgericht klar, dass Regelungen aus EU-Richtlinien zwar in bestimmten Fällen unmittelbare Wirkung entfalten können – nämlich dann, wenn Mitgliedstaaten die Richtlinien nicht fristgerecht oder unzureichend umgesetzt haben und die fragliche Vorschrift inhaltlich unbedingt und hinreichend bestimmt ist.
Allerdings kann diese unmittelbare Anwendung von Richtlinien-Vorschriften lediglich dazu dienen, Rechte des Einzelnen zu begründen. Der Grundsatz von Treu und Glauben hindert den Mitgliedstaat, der die unzureichende oder verspätete Umsetzung der Richtlinie zu verantworten hat, daran, diese Richtlinien-Vorschriften als Ermächtigungsgrundlage für ein staatliches Vorgehen gegen den Einzelnen zu nutzen, das dessen Grundrechte – wie hier die persönliche Freiheit – beschränkt.
Fazit des Urteils
Die beanstandeten Entscheidungen, die die Festnahmen für rechtmäßig erklärten, wurden aufgehoben. Das Urteil bekräftigt damit das Gesetzlichkeitsprinzip und den Richtervorbehalt im deutschen Recht bei jeder Form der Freiheitsentziehung und stellt sicher, dass selbst im Kontext von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen die Freiheit des Einzelnen nur auf Basis eines klaren nationalen Gesetzes eingeschränkt werden darf.
Quelle: Bundesverfassungsgericht
Abbildung: pixabay.com the-federal-constitutional-court-5180750_1280.jpg