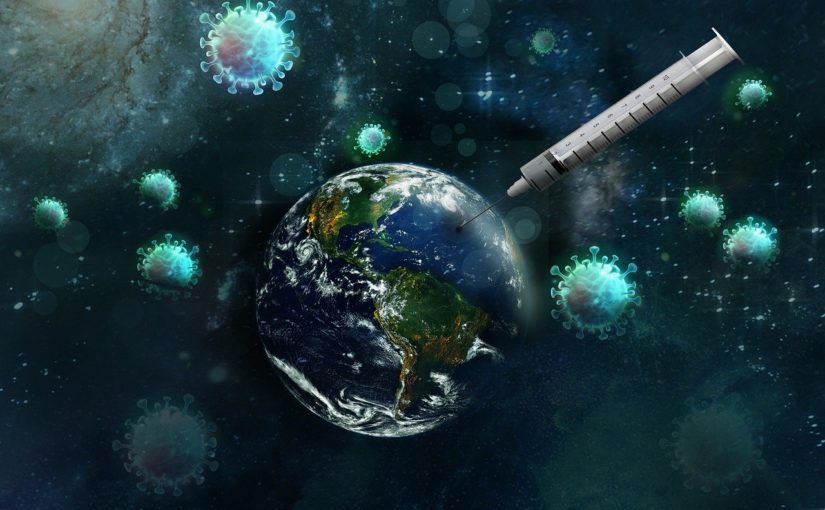Bei der Diskussion um die unweigerlich drohende nächste Rentenreform der kommenden Bundesregierung lohnt sich ein Blick auf unser Nachbarland. Während hierzulande die Marktwirtschafts-Ideologen darauf drängen, der gesetzlichen Rente mit einer kapitalgedeckten Finanzierung den Garaus zu machen, scheint die umlagefinanzierte Rente in Österreich weiterhin erfolgreich zu sein und wird kaum in Frage gestellt.
Tu felix Austria
Nun gibt es einen Impuls-Beitrag der Hans-Böckler-Stiftung von Florian Blank und Eric Türk, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler bei der Arbeiter- und Angestelltenkammer Wien, in dem die deutsche Rente mit der österreichischen Pensionsversicherung verglichen wird.
Der Vergleich mache vor allem deshalb Sinn, so die Wissenschaftler, weil beide Systeme sich ursprünglich sehr ähnlich waren. Aber die österreichische Pensionsversicherung wurde „fortentwickelt“, etwa durch die Einbeziehung von Selbstständigen, während die gesetzliche Rente in Deutschland zum „Teil eines weiter gefassten Versorgungsmixes degradiert“ wurde.
Modellbiografien der OECD
Die Gegenüberstellung der Rentenansprüche für einheitliche, idealtypische Biografien ermöglicht den Vergleich von Unterschieden der Rentensysteme selbst. Die von der OECD erstellten Modellbiografien mit durchgehenden Erwerbsverläufen, abschlagsfreiem Renteneintritt und stabilen Einkommenspositionen bilden den Ausgangspunkt für den Vergleich der Rentenversicherungen Deutschlands und Österreichs. Die Vorgehensweise der OECD wird dargestellt, sofern erforderlich korrigiert, aktualisiert und weiterentwickelt. Zusätzlich werden Arbeitslosigkeit, vorzeitiger Renteneintritt sowie Kindererziehungszeiten berücksichtigt. Durch diese Ergänzungen werden eine höhere Realitätsanbindung erreicht und Elemente des sozialen Ausgleichs einbezogen. Es zeigt sich, dass die österreichische Pensionsversicherung in jeder Konstellation deutlich höhere Leistungen gewährt, die Elemente des sozialen Ausgleichs den Abstand teils vergrößern, teils verringern.
Beispiele
An drei Beispielen wird deutlich, um wie viel höher die gesetzlichen Renten in Österreich ausfallen.
Standardfall
Eine Person mit durchschnittlichem Verdienst und 45 Berufsjahren, die jetzt das Erwerbsleben beginnt bekäme später, wenn sie in Rente geht:
- in Deutschland 39 Prozent,
- in Österreich 78 Prozent
ihres vorherigen durchschnittlichen Bruttoeinkommens.
mit Arbeitslosigkeit
Jemand verdient zunächst unterdurchschnittlich, steigert sich gegen Ende der Erwerbsphase auf ein überdurchschnittliches Einkommen, verliert aber mit 59 den Job, findet keinen neuen und geht mit 63 vorzeitig in Rente. Die voraussichtliche Rente beträgt:
- in Deutschland 30 Prozent,
- in Österreich 65 Prozent
Kindererziehung
Nach vier Jahren Vollzeittätigkeit erfolgt eine dreijährige Unterbrechung zur Kinderbetreuung, anschließend Teilzeitarbeit und nach einer weiteren Vollzeitphase wieder Arbeit mit reduzierter Stundenzahl. Die voraussichtliche Rente beträgt:
- in Deutschland 42 Prozent,
- in Österreich 78 Prozent
Deutlich höhere Rente in Österreich
Nicht nur zukünftige Rentner stehen in Österreich besser da. Bereits heute liegen die Pensionen in Österreich höher als die deutschen Renten. Dabei liegt das Renteneintrittsalter in Österreich nach wie vor bei 65 Jahren und eine Anhebung ist nicht geplant.
Höhere Rentenbeiträge
Der monatliche Rentenbeitragssatz liegt allerdings mit 22.8 Prozent wesentlich höher als in Deutschland mit 18.6 Prozent, wobei der Arbeitgeberanteil mit 12,55 Prozent höher ist als der Arbeitnehmeraneil mit 10.25 Prozent. Beim deutschen Beitrag sind allerdings nicht eventuelle Aufwendungen für private Zusatzvorsorge eingerechnet. Dazu kommt, dass der Beitragssatz in Deutschland laut Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung ab Mitte der 20er Jahre auf bis Mitte der 30er Jahre ebenfalls über 22 Prozent betragen wird, das Rentenniveau wird dagenen nur müsam gehalten werden können.
Längere Wartezeiten
Ein weiterer Unterschied zwischen Deutschland und Österreich sind die unterschiedlichen Wartezeiten. In Österreich muss man wesentlich länger in die Rentenversicherung einzahlen, bevor man Rente beziehen kann. So wird ein Teil der niedrigen Renten, die in Deutschland gezahlt werden, in Österreich gar nicht erst fällig. EIne genaue Beschreibung über die österreichische Pensionsversicherung kann man in einer Broschüre, herausgegeben von der Deutschen Rentenversicherung, nachlesen.
Besser keine (Teil-) Privatisierung
Florian Blank und Eric Türk werben allerdings für eine „Stärkung der Sozialversicherung als ein flexibles Instrument der sozialen Sicherung“. Sowohl das generelle Leistungsniveau als auch spezielle Maßnahmen des sozialen Ausgleichs ließen sich im System der gesetzlichen Rente zielgenau politisch steuern, was mit einer fortgesetzten Teilprivatisierung der Rente kaum gelänge.
Quellen: Hans-Böckler-Stiftung, OECD, Deutsche Rentenversicherung, BMAS
Abbildung: pixabay.com old-people-1555705_1920.jpg