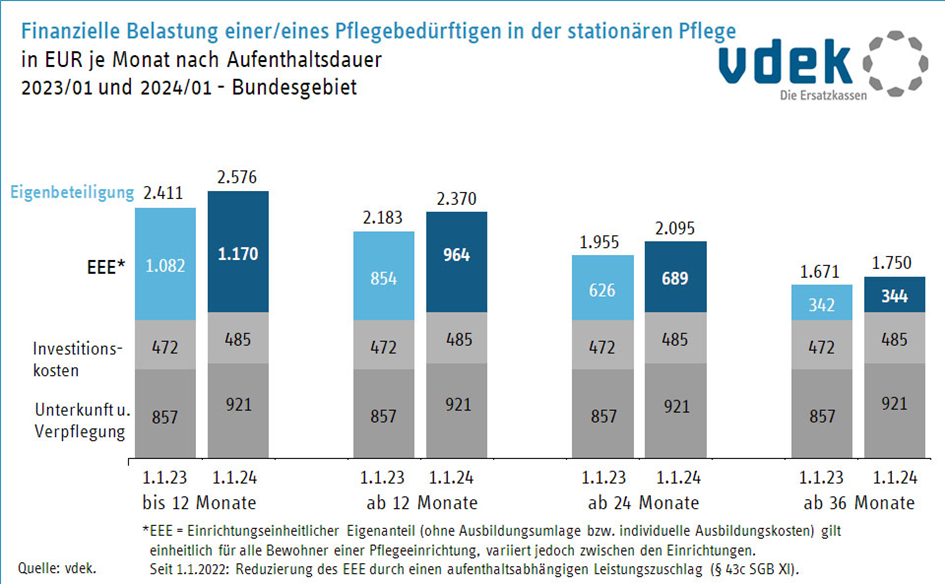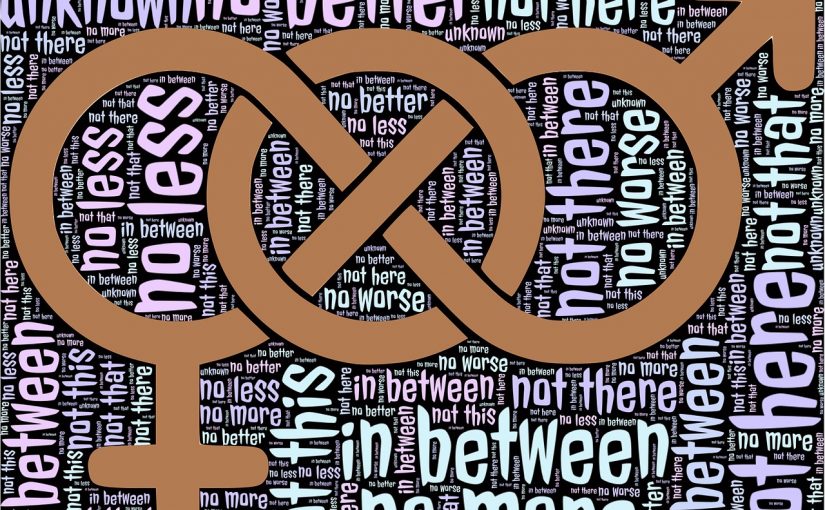Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bestimmt nach § 56 Absatz 1 SGB V in Richtlinien die zahnmedizinischen Befunde, für die Festzuschüsse zum Zahnersatz nach § 55 SGB V gewährt werden und ordnet den Befunden zahnprothetische Regelversorgungen zu („befundbezogenes Festzuschusssystem“).
befundbezogene Festzuschüsse
Versicherte haben Anspruch auf medizinisch notwendige Versorgung mit Zahnersatz (zahnärztliche Behandlung und zahntechnische Leistungen).
Die Krankenkassen gewähren zu den Aufwendungen für Zahnersatz befundbezogene Festzuschüsse. Patientinnen und Patienten können beim Zahnersatz zwischen jeder medizinisch anerkannten Versorgungsform wählen (vgl. § 55 Abs. 1 SGB V). Der Festzuschuss beträgt 60 % der festgelegten Kostenobergrenzen für bestimmte Zahnersatzleistungen. Gute Zahnpflege und nachgewiesene regelmäßige Kontrolluntersuchungen führen zu höheren Zuschüsse. Wer seine Zähne in den letzten fünf Jahren jeweils jährlich hat untersuchen lassen, kann den Zuschuss um einem Bonus auf 70 % erhöhen. Bei Minderjährigen ist zur Erlangung dieses Vorteils der Nachweis einer halbjährlich Untersuchung erforderlich. Gelingt der Nachweis der regelmäßigen Untersuchung sogar in den letzten 10 Jahren, so erhöht sich der Bonus noch einmal auf 75 % des Festbetrages.
jährliche Anpassung
Jedes Jahr passt der G-BA die Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge bei der Versorgung mit Zahnersatz (ZE) an die Ergebnisse der Verhandlungen über den zahnärztlichen ZE-Punktwert und die zahntechnischen Bundesmittelpreise an.
Auf Grundlage der Ergebnisse der diesjährigen Verhandlungen zwischen den jeweiligen Vertragspartnern Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV),
Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) und dem Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI), wurde die Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge bei der Versorgung mit Zahnersatz mit Wirkung vom 1. Januar 2024 angepasst.
4,22 Prozent mehr
Dabei wurden die zahnärztlichen Leistungen auf Basis des aufgrund der Anhebung des bundeseinheitlichen durchschnittlichen Punktwertes für Zahnersatz entsprechend der Vereinbarung zwischen der KZBV und dem GKV-Spitzenverband ab dem 1. Januar 2024 in Höhe von 1,0827 € (+ 4,22 % ggü. JD 2023) berechnet.
Die Berechnungen für die zahntechnischen Leistungen basieren auf der Vereinbarung der bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise zwischen dem VDZI und dem GKV-Spitzenverband vom November 2023. Die Kosten für das Verbrauchsmaterial Praxis und die Kosten für die Prothesenzähne wurden analog
zu den Veränderungen der Preise der zahntechnischen Leistungen (+4,22 % ggü. Jahr 2023) fortgeschrieben.
Beispiel
Der Festzuschuss für eine Metallische Vollkrone beträgt demnach 2024 365,96 Euro, bestehend aus 184,59 Euro zahnärztlicher Leistung und 181,37 Euro zahntechnischer Leitung. Im Jahr 2023 betrug der Gesamtfestzuschuss 351,14 Euro.
Der Versicherte erhält einen Zuschuss von
- 60 Prozent (ohne Bonus): 219,58 Euro
- 70 Prozent (mit Bonus 1): 256,17 Euro
- 75 Prozent (mit Bonus2): 274,477 Euro
- 100 Prozent (Härtefall): 365,96 Euro
Härtefall
Versicherte mit einem geringen Einkommen (zum Beispiel Sozialhilfeempfänger, Empfänger von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, Empfänger von Bürgergeld und Ausbildungsförderung), die Zahnersatz benötigen, bekommen von ihrer Krankenkasse einen zusätzlichen Festzuschuss; damit erhalten sie die Regelversorgung kostenfrei. Dies gilt auch für Versicherte, die in einem Heim oder einer ähnlichen Einrichtung leben, dessen Kosten von einem Träger der Sozialhilfe oder der Sozialen Entschädigung getragen werden.
Geringes Einkommen
Ebenfalls 100 Prozent Zuschuss erhalten Versicherte, deren monatliche Bruttoeinnahmen 40% der monatlichen Bezugsgröße nicht überschreiten, das das heißt für das Jahr 2024 monatliche Bruttoeinnahmen bis zu 1.414,00 EUR für Alleinstehende. Die Einkommengrenze erhöht sich für den ersten im Haushalt lebenden Angehörigen um 530,25 EUR und für jeden weiteren Angehörigen um 353,50 EUR.
Übersteigt das Einkommen diese Einkommensgrenzen, so steigen die einzubringenden Eigenmittel kontinuierlich an. Versicherte mit höherem Einkommen müssen bis zum Dreifachen des Betrages selbst leisten, um den ihr Einkommen die maßgeblichen Einkommensgrenze übersteigt. Wer beispielsweise als Alleinstehender 1.442,00 EUR verdient, liegt 28,00 EUR über der Zuzahlungsbefreiungsgrenze (1.414,00 EUR) und muss daher für die Regelversorgung maximal 84,00 EUR an Eigenbeteiligung leisten.
Quellen: G-BA, SOLEX, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: pixabay.co dentist-4374683_1280.jpg