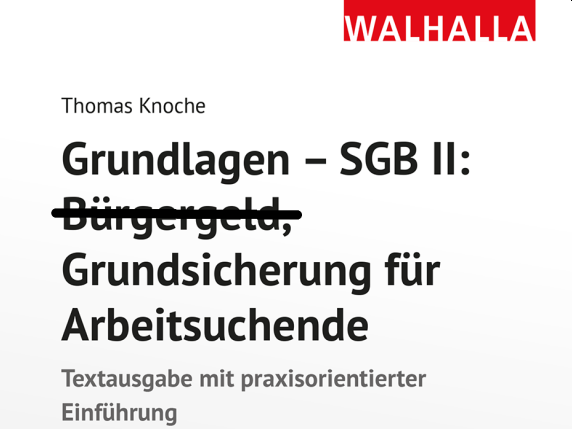Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf zur „Effektivierung des Gewaltschutzes in Hochrisikofällen“ (21/3068) vorgelegt. Damit sollen bestehende Schutzlücken im Umgang mit häuslicher Gewalt geschlossen werden. Der zivilrechtliche Gewaltschutz habe „einen unvermeidlichen zeitlichen Vorlauf“ und sei „nicht immer das optimale Schutzinstrument“, heißt es in der Begründung.
Hochrisikofälle
Mit der Neuregelung soll laut Länderkammer insbesondere auf Fälle reagiert werden, in denen Täter trotz gerichtlicher Schutzanordnungen weiter eskalierend handeln. Die Länderkammer verweist darauf, dass zivilrechtliche Gewaltschutzanordnungen zwar schnell ergehen könnten, deren praktische Wirksamkeit jedoch maßgeblich von verfahrens- und vollstreckungsrechtlichen Vorgaben abhänge. In streitigen oder manipulativen Konstellationen verfügten die Familiengerichte zudem nicht über die gleichen Ermittlungsinstrumente wie die Polizei. Dies könne dazu führen, dass hochgefährliche Täter trotz mehrfacher Verstöße nicht effektiv gestoppt würden.
Nach Darstellung des Bundesrates zeigen insbesondere Hochrisikofälle im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz deutliche Parallelen zu eskalierenden Stalking-Fällen. Das bestehende System aus Schutzanordnung, Ordnungsmitteln und zivilrechtlicher Vollstreckung könne dieser Dynamik nicht hinreichend entgegenwirken, da Ordnungsgelder nicht selten ins Leere gingen und Vollstreckungsverfahren zeitverzögernd wirkten. In solchen Situationen bedürfe es „wirksamer und abschreckender Interventionsmöglichkeiten, durch die gewalttätige Personen frühzeitig konsequent gestoppt und aktiv zur Verantwortung gezogen werden können“, heißt es weiter.
Strafrahmen anheben
Vor diesem Hintergrund schlägt der Bundesrat vor, den Strafrahmen für besonders schwere Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz deutlich anzuheben. Künftig sollen etwa Zuwiderhandlungen, bei denen Täter Waffen mit sich führen, das Opfer erheblich gefährden oder durch wiederholte und fortgesetzte Taten dessen Lebensgestaltung maßgeblich beeinträchtigen, mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren geahndet werden können. Zudem soll in diesen Fällen die Möglichkeit einer vorbeugenden „Deeskalationshaft“ nach Paragraf 112a Strafprozessordnung eröffnet werden. Nach Auffassung des Bundesrates entspricht dies den Erfordernissen eskalierender Gewaltbeziehungen, in denen Täter trotz polizeilicher Gefährderansprachen und zivilgerichtlicher Anordnungen nicht von weiteren Übergriffen abgehalten werden können. Durch eine befristete Inhaftierung könne eine akute Gewaltspirale unterbrochen und das Opfer geschützt werden, bevor sich das Risiko schwerer Gewalttaten weiter verdichte.
Verbesserung des Informationsflusses
Ein weiterer Schwerpunkt des Entwurfs liegt auf der Verbesserung des Informationsflusses zwischen Familiengerichten und Polizei. Künftig sollen die Polizeibehörden bereits mit Eingang eines Antrags auf eine Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz unterrichtet werden. Dies soll den Behörden ermöglichen, Gefährdungslagen frühzeitig einzuschätzen, Erreichbarkeiten zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen der Gefahrenabwehr vorzubereiten. Nach Angaben des Bundesrates können so Schutzlücken vermieden werden, die entstehen, wenn eine verletzte Person noch vor Zustellung einer Entscheidung bedroht oder angegriffen wird.
Internationale Verpflichtungen
Der Entwurf verweist auf bestehende Defizite im Gewaltschutzrecht, insbesondere bei der praktischen Durchsetzung gerichtlicher Schutzanordnungen. Es wird auf internationale Verpflichtungen (Istanbul-Konvention, EU-Richtlinie 2024/1385) und Kritik aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft hingewiesen, wonach Sanktionen zu selten und nicht abschreckend genug seien. Statistiken zeigen steigende Fallzahlen bei Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz, aber vergleichsweise wenige Verurteilungen. Der Entwurf nimmt auch Bezug auf Forschungsergebnisse zu Dynamiken häuslicher Gewalt und Femiziden und greift Anregungen aus der familiengerichtlichen Praxis auf.
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Der Entwurf ist vom Bundesrat eingebracht. Die Bundesregierung hat einen eigenen, parallelen Gesetzentwurf mit ähnlichen Zielen (u.a. elektronische Aufenthaltsüberwachung, Täterarbeit) vorgelegt und prüft die Vorschläge des Bundesrates teilweise. Der Entwurf ist mit EU- und völkerrechtlichen Vorgaben vereinbar. Die Regelungen sind insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Istanbul-Konvention und der neuen EU-Richtlinie von Bedeutung. Der Entwurf nimmt gezielt Hochrisikofälle in den Blick und enthält eine Verschärfung der Sanktionen für besonders schwere Verstöße. Eine besondere Eilbedürftigkeit wird nicht explizit erwähnt, aber die Dringlichkeit ergibt sich aus der Zielsetzung, Schutzlücken zu schließen und internationale Vorgaben umzusetzen.
Quellen: Bundesrat, Bundeskabinett, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: pixabay.com blue-light-73088_1280.jpg