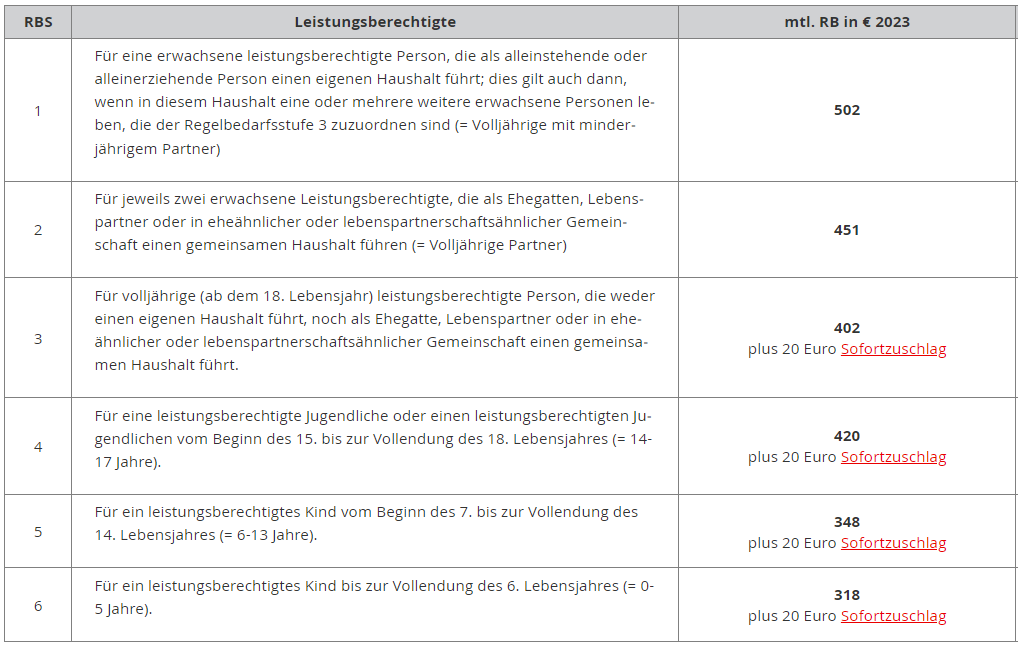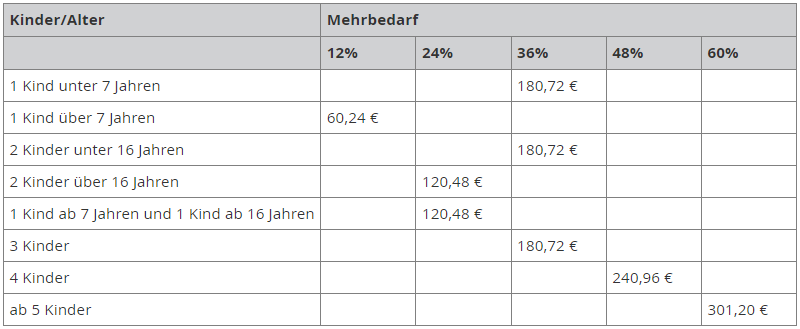Details zum Bürgergeld (9)
Die Eingliederungsvereinbarung heißt ab 1.7.2023 Kooperationsplan. Der Kooperationsplan soll der „rote Faden“ für die Arbeitssuche und wird in verständlicher Sprache gemeinschaftlich von Jobcenter-Beschäftigten und Bürgergeld-Beziehenden erarbeitet.
Unterschied zur Eingliederungsvereinbarung
Der wesentliche Unterschied zur Eingliederungsvereinbarung ist, dass der Kooperationsplan ist für beide Seiten rechtlich unverbindlich ist. Er bietet selbst keine Grundlage für den Eintritt von Leistungsminderungen. Es können aber auch keine im Kooperationsplan festgehaltene Leistungen des Jobcenters wie z.B. die Finanzierung einer Bildungsmaßnahme oder die Übernahme von Bewerbungskosten eingeklagt werden.
Instrument zur kooperativen Planung
Der Kooperationsplan wird auf seine wesentliche Funktion als Instrument zur kooperativen Planung des Integrationsprozesses konzentriert. Die Zusammenarbeit soll mit einem Verfahren zur Ermittlung der Kompetenzen des Hilfesuchenden beginnen (Potenzialanalyse).
Potenzialanalyse
Die Potenzialanalyse dient dazu, durch eine umfassende Betrachtung des Menschen, seine Bedarfe, Fähigkeiten und Verhältnisse, individuelle Handlungs- und Unterstützungsbedarfe zu erkennen, um die hierzu erforderliche Unterstützung zu planen und Handlungsoptionen zu entwickeln. Hierbei ist auch zu prüfen, ob Rehabilitationsbedarfe vorliegen (§ 9 Absatz 4 SGB IX) oder Flankierende Maßnahmen erforderlich sind.
Gerade auch die Stärken der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sollen mit in den Blick genommen werden, darunter auch formale und non-formale Qualifikationen und sogenannte Soft Skills (Soziale Kompetenz). Diese sollen bei der Gestaltung des Eingliederungsprozesses und der Festlegung des Eingliederungsziels berücksichtigt werden.
Inhalt der Kooperationsplans
Im Kooperationsplan soll insbesondere festgelgt werden.
| 1. | welche Leistungen zur Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nach diesem Abschnitt in Betracht kommen, |
| 2. | welche für eine erfolgreiche Überwindung von Hilfebedürftigkeit, vor allem durch Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit, erforderlichen Eigenbemühungen erwerbsfähige Leistungsberechtigte mindestens unternehmen und nachweisen, |
| 3. | eine vorgesehene Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder an einer Maßnahme der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes, |
| 4. | wie Leistungen anderer Leistungsträger in den Eingliederungsprozess einbezogen werden, |
| 5. | in welche Ausbildung, Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person vermittelt werden soll und |
| 6. | ob ein möglicher Bedarf für Leistungen zur beruflichen oder medizinischen Rehabilitation mit dem Ziel einer entsprechenden Antragstellung in Betracht kommt. |
Weitere mögliche Inhalte
Im Kooperationsplan kann auch festgehalten werden, welche Maßnahmen und Leistungen der aktiven Arbeitsförderung im Hinblick auf mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen, die einer Integration in den Arbeitsmarkt entgegenstehen, in Betracht kommen und welche anderen Leistungsträger im Hinblick auf diese Beeinträchtigungen voraussichtlich zu beteiligen sind.
Der Kooperationsplan kann daneben auch Arbeitsmarktzugänge über mögliche Tätigkeitsbereiche näher beschreiben und auf die Unterstützungsmöglichkeiten für andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft eingehen.
Quellen: BMAS, SOLEX, Thomas Knoche: Grundlagen – SGB II: Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende, Walhalla Fachverlag; 3., aktualisierte Edition (28. Februar 2023)
Abbildung: Fotolia_113739057_Subscription_XL.jpg