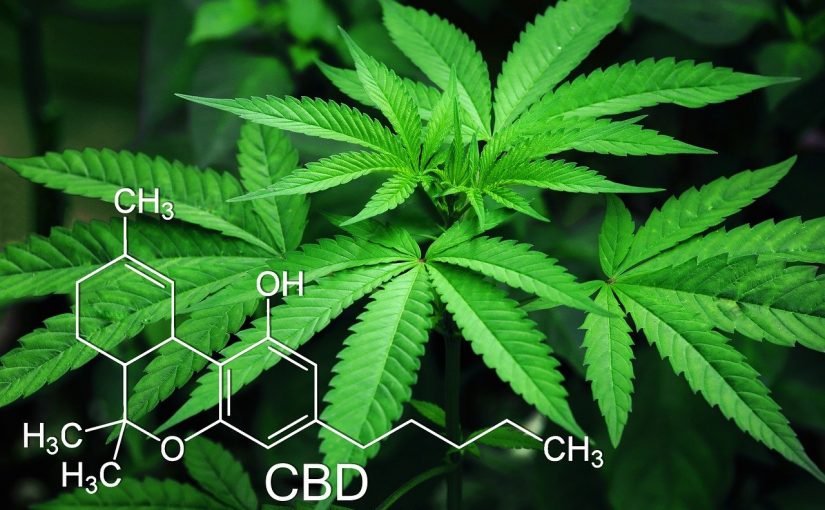Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 19. Oktober 2023, nach halbstündiger Aussprache über den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transparenz (20/8408) ab. Dazu legt der Gesundheitsausschuss eine Beschlussempfehlung vor.
Über Stellungnahmen zum Gesetz von Verbänden und Gewerkschaft berichteten wir hier am 26. September 2023.
Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen
Mit einem Transparenzverzeichnis soll die Bevölkerung künftig über verfügbare Leistungen und die Qualität von Krankenhäusern informiert werden. Das soll Patienten helfen, eine selbstbestimmte und qualitätsorientierte Auswahlentscheidung für die jeweilige Behandlung zu treffen. Das Online-Verzeichnis ist Teil der geplanten umfassenden Krankenhausreform und soll am 1. April 2024 freigeschaltet werden, wie aus dem Gesetzentwurf hervorgeht.
Mit dem Krankenhaustransparenzgesetz werden die Krankenhäuser dazu verpflichtet, die erforderlichen Daten über ihre personelle Ausstattung, das Leistungsangebot und bestimmte Qualitätsaspekte zu übermitteln. Aufbereitet werden die Daten vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) sowie vom Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG). Das Leistungsangebot der Krankenhäuser soll differenziert nach 65 Leistungsgruppen dargestellt werden.
Zuordnung zu Versorgungsstufen
Ferner ist die Zuordnung der einzelnen Krankenhausstandorte zu Versorgungsstufen (Level) geplant, abhängig von der Anzahl und Art der vorgehaltenen Leistungsgruppen. Dies soll eine niedrigschwellige Einschätzung ermöglichen, wie das Leistungsspektrum eines Krankenhauses einzuordnen ist, also ob dort komplexe Eingriffe oder eine Grund- und Regelversorgung erbracht werden können.
Vorgesehen sind Level der Stufen 1 bis 3 sowie eigene Level für Fachkrankenhäuser und sektorenübergreifende Versorger (Level F und Level 1i). Krankenhäuser mit Level 3 sollen eine umfassende Versorgung von Patienten gewährleisten. Der Level 3U steht dabei noch einmal separat für Hochschulkliniken. Häuser mit Level 2 sollen eine erweiterte Versorgung sicherstellen. Level-1n-Krankenhäuser sollen die Basisversorgung inklusive der Notfallmedizin leisten können.
Die Veröffentlichung des Transparenzverzeichnisses hat nach Angaben der Koalitionsfraktionen keine Auswirkungen auf die Krankenhausplanung der Länder und die Krankenhausvergütung. Die Festlegung und Ausgestaltung von Leistungsgruppen soll einer künftigen Krankenhausreform vorbehalten bleiben.
Quellen: Bundestag, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: pixabay.com night-view-767852_1280.jpg