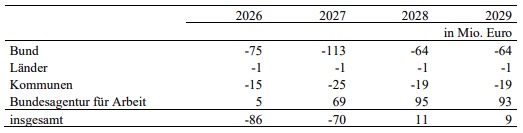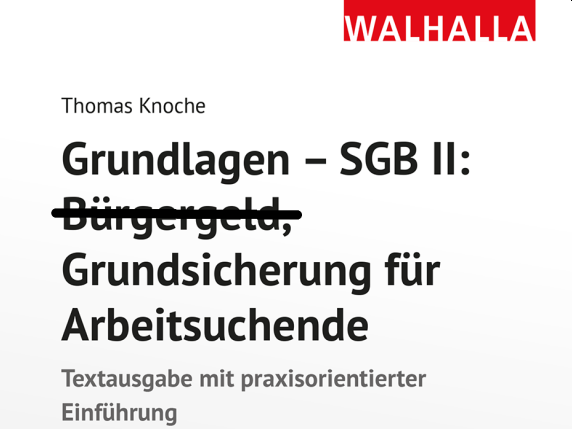Am 6.11.2025 hat der Bundestag das „Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP)“ beschlossen. Der Bundesrat stoppte das Gesetz zunächst wegen diesem Gesetz „angehängten“ fachfremden Regelungen, mit denen in die Finanzierung von Krankenhäusern eingegriffen werden sollte. Am 19.12.2025 wurde BEEP dann endgültig verabschiedet.
Eigentlicher Schwerpunkt des Gesetzes sind zahlreiche Änderungen die Pflege betreffend. Es sieht zahlreiche Maßnahmen vor, um diese auf mehr Schultern zu verteilen, die Versorgung in der Fläche zu sichern, den Pflegeberuf attraktiver zu machen und Bürokratie abzubauen. Das Gesetz bringt zudem eine Reihe weiterer Änderungen mit sich, darunter einen verbesserten Zugang zu Präventionsdiensten für Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Pflegekräfte erhalten mehr medizinische Befugnisse, die bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind oder von diesen angeordnet werden müssen. Ebenfalls werden Anträge und Formulare für Pflegeleistungen vereinfacht. Insgesamt weist das Gesetz mehr als 80 Änderungen im SGB XI auf.
Leistungsrechtliche Änderungen
Prävention wird gestärkt (§ 5 Abs. 1a SGB XI (neu))
Bisher wurde nur für Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen die Prävention explizit gefördert. Ab dem 1. Januar 2026 sollen die Pflegekassen auch Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege den Zugang zu Präventionsleistungen der Krankenkassen ermöglichen und aktiv unterstützen.
Die Pflegekassen müssen dabei zwei neue Aufgaben wahrnehmen:
- Fachliche Beratung: Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und Pflegepersonen erhalten gezielte Informationen darüber, welche Möglichkeiten Gesundheitsförderung und Prävention bieten, um die gesundheitliche Situation zu verbessern und Ressourcen zu stärken.
- Präventionsempfehlung: Pflegefachpersonen und qualifizierte Pflegeberater können künftig konkrete Präventionsmaßnahmen empfehlen. Diese Empfehlung soll frühestmöglich nach Feststellung der Pflegebedürftigkeit erfolgen – idealerweise bereits im Anschluss an die Begutachtung, in der Pflegeberatung nach §§ 7a und 7c SGB XI, im Zusammenhang mit der Erbringung der Pflegesachleistungen nach § 36 oder bei Beratungsbesuchen nach § 37 Abs. 3 SGB XI.
Pflegekassen werden zur Sicherstellung der Beratung verpflichtet (§ 7a Abs. 8 SGB XI)
Dem bisherigen Absatz 8 wird folgender Satz vorangestellt: „Die Pflegekassen stellen eine angemessene Beratung ihrer Versicherten sicher.“ In einer weiteren Ergänzung wird klargestellt, dass die Pflegekassen ihre Beratungsaufgaben ganz oder teilweise auf Dritte übertragen können.
Bericht zum Anstieg der Pflegebedürftigkeit bis 30.6.2026 (§ 15 Abs. 8 SGB XI)
Der GKV-Spitzenverband muss bis zum 30.6.2026 dem Bundesgesundheitsministerium einen wissenschaftlich fundierten Bericht vorlegen. Dies soll wohl der Vorbereitung der nächsten großen Pflegereform, an der aktuell auch die Bund-Länder-AG arbeitet, dienen. Der Bericht soll zwei Schwerpunkte haben: Erfahrungen und Wirkungsweisen des Begutachtungsinstruments und Vorschläge zur Weiterentwicklung sowie Gründe für den überproportionalen Anstieg der Pflegebedürftigen.
Elektronische Mitteilung bei eilbedürftigen Pflegeanträgen (§ 18c Abs. 1 Satz 3 SGB XI)
Bei einer sogenannten Eilbegutachtung müssen die Pflegekassen das Ergebnis unverzüglich dem Antragsteller mitteilen. Ob und wann das Entlassmanagement, welches den Eilantrag ausgelöst hat, informiert wird, ist dagegen nicht geregelt. Das wird nun geändert. Sofern die antragstellende Person eingewilligt hat, muss die Pflegekasse auch das Entlassmanagement unverzüglich informieren und zwar in elektronischer Form.
Strafzahlung bei Fristüberschreitung innerhalb von 15 Arbeitstagen (§ 18c Abs. 5 Satz 1 SGB XI)
Hält die Pflegekasse die Bearbeitungsfrist für Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit oder Anträge auf einen höheren Pflegegrad von 25 Arbeitstagen nicht ein und hat die Verzögerung zu verantworten, war bisher nicht geregelt, wann die 70 € je angefangene Woche der Fristüberschreitung zu zahlen sind. Mit der neuen Regelung ab 1.1.2026 nimmt der Gesetzgeber jetzt eine konkrete Regelung vor. Danach müssen die Pflegekassen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Fristablauf zahlen. Das gilt auch, wenn eine der verkürzten Begutachtungsfristen (5 Arbeitstage, 10 Arbeitstage) durch den MD nicht eingehalten wird. Wie bisher gilt: Ist der Antragsteller bereits in vollstationärer Pflege und hat mindestens Pflegegrad 2, besteht kein Anspruch auf diese Strafzahlung.
Neue Regelungen zum Ruhen des Pflegegeldes (§ 34 SGB XI)
Das Pflegegeld wird künftig in folgenden Fällen weitergezahlt:
- bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Ausland (nicht EU/EWR oder Schweiz) für die Dauer von bis zu acht Wochen
- je Kalenderjahr sowie n je stationärem Aufenthalt im Krankenhaus oder einer Rehabilitations-/Vorsorgeeinrichtung für die Dauer von acht Wochen
Klargestellt wird zudem, dass auch die Leistungen zur Sozialen Sicherung der Pflegeperson für die Dauer von bis zu acht Wochen in diesen Fällen weitergezahlt werden.
Weniger Beratungseinsätze bei Pflegerad 4 oder 5 (§ 37 Abs. 3 SGB XI)
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die Pflegegeld beziehen, haben halbjährlich einmal eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit abzurufen. Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5 können vierteljährlich einmal eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit in Anspruch nehmen.
Das bedeutet: Die bisherige Verpflichtung zu vierteljährlichen Beratungsbesuchen bei Pflegegrad 4 und 5 wird in ein Wahlrecht umgewandelt. Sie können vierteljährlich eine Beratung abrufen, verpflichtend ist diese nur noch halbjährlich.
Zudem sollen ambulante Pflegedienste und Pflegefachpersonen, die die Beratungseinsätze durchführen, das Beratungsprotokoll direkt auf elektronischem Weg an die Pflegekassen senden oder maschinell verwertbar auf Datenträgern zur Verfügung stellen.
Ausschlussfrist bei Kostenerstattung der Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI)
Es wird eine sogenannte Ausschlussfrist eingeführt. Wird diese Frist versäumt, erlischt der Anspruch auf Kostenerstattung unwiderruflich – eine verspätete Antragstellung ist dann ausgeschlossen.
Höhere Leistungen für Digitale Pflegeanwendungen (§ 40b SGB XI)
Bisher dürfen Pflegekassen pro Monat insgesamt nur 53 Euro zahlen für die Nutzung von Digitalen Pflegeanwendungen (DiPA) und die dazu erforderliche Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst. Künftig zahlt die Pflegekasse für die DiPA bis zu 40 Euro und für die Unterstützung zusätzlich bis zu 30 Euro pro Monat.
Neue Versorgungsform „stambulant“ (§ 45h SGB XI)
Pflegebedürftige in gemeinschaftlichen Wohnformen mit Verträgen zur pflegerischen Versorgung gemäß § 92c erhalten künftig einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 450 Euro je Kalendermonat zur Sicherstellung einer selbstbestimmten Pflege.
Zusätzliche Leistungen: Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben zudem je Kalendermonat Anspruch auf körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung als Sachleistung gemäß § 36 SGB XI. Wenn der Sachleistungsbetrag nur teilweise in Anspruch genommen wird, besteht Anspruch auf anteiliges Pflegegeld (§ 38 Satz 1 und 2 i. V. m. § 37 SGB XI).
Weitere mögliche Leistungen: Es können zudem Leistungen gemäß den §§ 7a, 39a, 40 Absatz 1 und 2 sowie den §§ 40a, 40b, 44a und 45 SGB XI in Anspruch genommen werden. Bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 besteht auch Anspruch auf Leistungen gemäß § 44 SGB XI sowie auf Kurzzeitpflege.
Sicherstellungsauftrag der Pflegekassen wird definiert (§ 69 SGB XI)
Die Pflegekassen erhalten einen ausdrücklichen Sicherstellungsauftrag: Sie haben eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse entsprechende pflegerische Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Die Pflegekassen müssen also aktiv dafür sorgen, dass ausreichend Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste zur Verfügung stehen. Zur Erfüllung des Sicherstellungsauftrags müssen sie die Erkenntnisse aus der Evaluation der regionalen Versorgungssituation, aus den Empfehlungen der Ausschüsse und aus Anzeigen von Pflegeeinrichtungen berücksichtigen. Die Pflegekassen müssen also die Versorgungssituation aktiv beobachten und bei Bedarf gegensteuern.
Leistungsbeträge stehen ab 2026 endlich im Gesetz
Die im SGB XI stehenden (veralteten) Leistungsbeträge wurden an den aktuellen Stand 1.1.2025 angepasst.
Neben diesen Änderungen im Leistungsrecht gibt es zahlreiche weitere Änderungen, z. B.:
- Die Personalbemessung wird weiterentwickelt und an den tatsächlichen Versorgungsbedarf angepasst.
- Digitale Verfahren sollen Antrags-, Dokumentations- und Prüfprozesse spürbar vereinfachen.
- Pflegefachpersonen erhalten in ausgewählten Bereichen erweiterte Befugnisse zur eigenverantwortlichen Durchführung bestimmter heilkundlicher Tätigkeiten – ein Baustein zur Entlastung und zur verbesserten Versorgung.
Quelle: SOLEX, FOKUS-Sozialrecht, Bundestag, Bundesrat
Abbildung: Fotolia_87266480_Subscription_XXL.jpg