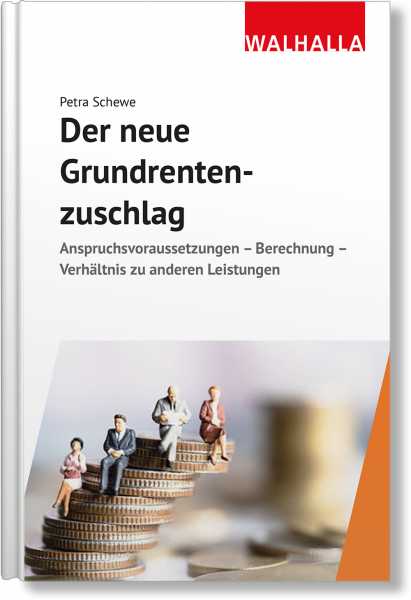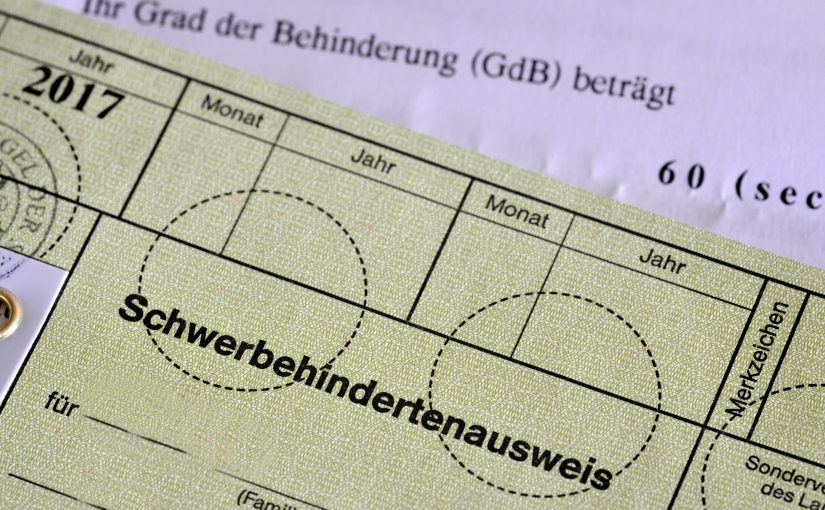Eines der Wahlkampfthemen ist eine Erhöhung des Mindestlohns. In diesem Zusammenhang taucht auch die Frage auf, ob nicht auch Beschäftigte in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung Anspruch auf Zahlung des Mindestlohs haben.
Behindertenrechtskonvention
Beschäftigte in den Werkstätten verdienen oft nur 180 bis 230 Euro im Monat. Das ist aber nicht der einzige Kritikpunkt an den Werkstätten. Ausgehend von der UN-Behindertenrechtskonvention, die auch Deutschland unterzeichnet hat, bemängeln sie, dass Behindertenwerkstätten im Widerspruch zu dem in der UN-BRK garantierten Recht auf Arbeit stünden. Die alternativlose Arbeit in WfbM sei meist nicht frei gewählt und die Beschäftigten könnten ihren Lebensunterhalt damit nicht bestreiten. Sie seien auf staatliche Unterstützung angewiesen. Im Jahr 2015 empfahl daher der Fachausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die Werkstätten in der Bundesrepublik schrittweise abzuschaffen.
Artikel 27
Artikel 27 Absatz 1 der UN-BRK lautet: „Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird.„
Nicht vergleichbar
Befürworter der WfbM führen dagegen an, dass ein Vergleich zwischen Werkstattbeschäftigten und Arbeitnehmern aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zielführend sei. Man müsse die Komplexität des Systems verstehen und dürfe das Bild nicht verzerren. Werkstätten würden aber nicht dem Mindestlohngesetz unterliegen, weil deren Beschäftigte keine Arbeitnehmer seien. Das Arbeitsentgelt „besteht aus einem Grundbetrag in Höhe eines Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit leistet, und einem leistungsangemessenem Steigerungsbetrag. Hinzu kommt ein öffentlich finanziertes Arbeitsförderungsgeld.
Unterstützungsangebote
In einer Behindertenwerkstatt stehe nicht die reine Erwerbsarbeit im Vordergrund. Sie biete zusätzlich pflegerische Unterstützung, Ergo- und Physiotherapie, Logopädie sowie Angebote aus dem Sport- und Kulturbereich – auch während der Arbeitszeit.
Außerdem sei der allgemeine Arbeitsmarkt in seiner jetzigen Form sei nicht in der Lage, alle Menschen mit Behinderungen aufzunehmen.
Rechtslage
Laut § 221 SGB IX stehen Menschen mit Behinderung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten in einem „arbeitnehmerähnlichen“ Rechtsverhältnis.
Das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis bedeutet, dass arbeitsrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Grundsätze angewandt werden müssen, insbesondere arbeitsrechtliche Grundsätze und Vorschriften über:
- Arbeitszeit,
- Urlaub,
- Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen,
- Erziehungsurlaub (Elternzeit) und Mutterschutz,
- Persönlichkeitsschutz und
- Haftungsbeschränkung.
Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter Berücksichtigung des zwischen den Menschen mit Behinderung und dem Rehabilitationsträger bestehenden Sozialleistungsverhältnisses durch Werkstattverträge zwischen den Menschen mit Behinderung und dem Träger der Werkstatt näher geregelt.
Arbeitsentgelt
Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen mit Behinderung ein Arbeitsentgelt, das sich aus einem Grundbetrag in Höhe des Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit nach den für sie geltenden Vorschriften Menschen mit Behinderung im Berufsbildungsbereich leistet, und einem leistungsangemessenen Steigerungsbetrag zusammensetzt. Der Steigerungsbetrag bemisst sich nach der individuellen Arbeitsleistung der Menschen mit Behinderung, insbesondere unter Berücksichtigung von Arbeitsmenge und Arbeitsgüte.
Die an Maßnahmen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich teilnehmenden behinderten Menschen erhalten Lohnersatzleistungen von den zuständigen Rehabilitationsträgern, soweit die Bundesagentur für Arbeit zuständig ist, i. d. R. Ausbildungsgeld
Arbeitergebnis
Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach § 12 Absatz 4 der Werkstättenverordnung werden die Auswirkungen der Vergütungen auf die Höhe des Arbeitsergebnisses dargestellt. Das Arbeitsergebnis der Werkstatt darf nicht zur Minderung der Vergütungen nach Absatz 3 verwendet werden. Verluste aus den Vergütungsvereinbarung (können beispielsweise entstehen, wenn etwa tarifliche Erhöhungen im Vereinbarungszeitraum höher ausfallen als in der Vergütungsvereinbarung prognostiziert) dürfen nicht aus dem Arbeitsergebnis gedeckt werden. Erzielte Überschüsse aus den Vergütungsvereinbarungen fließen dagegen in das Arbeitsergebnis ein und müssen in dem in § 12 Abs. 5 Werkstättenverordnung (WVO) vorgeschriebenen Umfang auch für die Entlohnung der behinderten Menschen verwendet werden. Das bedeutet, dass das Arbeitsentgelt zwar angehoben werden darf, aber es darf nicht gekürzt werden.
Grundbetrag
Die Zahlung eines Grundbetrages in Höhe des Ausbildungsgeldes stellt sicher, dass die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen kein geringeres Arbeitsentgelt erhalten als den Betrag, den die überwiegende Zahl der behinderten Menschen in der Zeit der Maßnahme im Berufsbildungsbereich zuletzt erhalten hat.
Das Ausbildungsgeld nach § 125 SGB III wurde zum 1.8.2019 auf 117 EUR und zum 1.8.2020 auf 119 EUR monatlich erhöht.
Um eine finanzielle Überforderung der Werkstätten zu vermeiden wurde mit § 241 Abs. 9 SGB IX eine Übergangslösung geschaffen, durch die der Grundbetrag erst zum 1.1.2023 wieder die gleiche Höhe wie das Ausbildungsgeld erreicht.
| Grundbetrag ab | Höhe mindestens |
|---|---|
| 1. August 2019 | 80 EUR |
| 1. Januar 2020 | 89 EUR |
| 1. Januar 2021 | 99 EUR |
| 1. Januar 2022 | 109 EUR |
| 1. Januar 2023 | 119 EUR |
Je nach wirtschaftlicher Situation der Werkstätten kann die Erhöhung des Grundbetrags dazu führen, dass der Steigerungsbetrag für leitungsstärkere Menschen in den Werkstätten geringer ausfällt.
Arbeitsgericht zum Mindestlohn
Urteil des Arbeitsgerichts Kiel vom 19.6.2015: „Der gesetzliche Mindestlohn soll Arbeitnehmer vor Niedriglöhnen schützen und existenzsichernde Arbeitsentgelte sichern. Das setzt allerdings reguläre Austauschverhältnisse zwischen Arbeitsleistung und Entgelt voraus und umfasst nicht sozialstaatliche und sozialversicherungsrechtliche Aufgaben zur Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben. Da für ein Werkstattverhältnis die soziale Betreuung und Anleitung von entscheidender Bedeutung ist, muss dieser Aspekt der angemessenen Vergütung für schwerbehinderte Menschen in Werkstätten berücksichtigt werden. Hierfür sind die Regeln für eine zweipolige Bewertung (Arbeit gegen Vergütung) nicht geeignet. Der Umstand, dass der Beschäftigte ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringt, ist kein Kennzeichen für ein Arbeitsverhältnis, sondern Aufnahmevoraussetzung für die Werkstatt nach § 219 Abs. 2 SGB IX“
Forderungen
Behindertenverbände fordern eine umfassende Reform des „Systems“ der Behindertenwerkstätten. Zum einen die Umsetzung der UN-BRK. Außerdem müssten Behindertenwerkstätten endlich konsequent an ihrem Hauptauftrag, Werkstattbeschäftigte langfristig in Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen, gemessen werden. Eine umfassende Darstellung des Werkstatt-Systems hat das Projekt JOBinklusive auf seiner Homepage zusammengestellt.
Quellen: RND, JOBinklusive, SOLEX
Abbildung: AdobeStock_267918909.jpeg