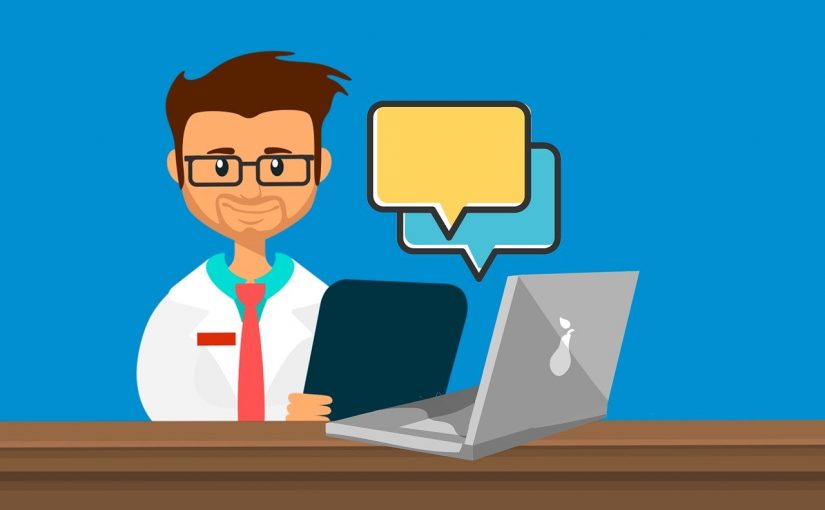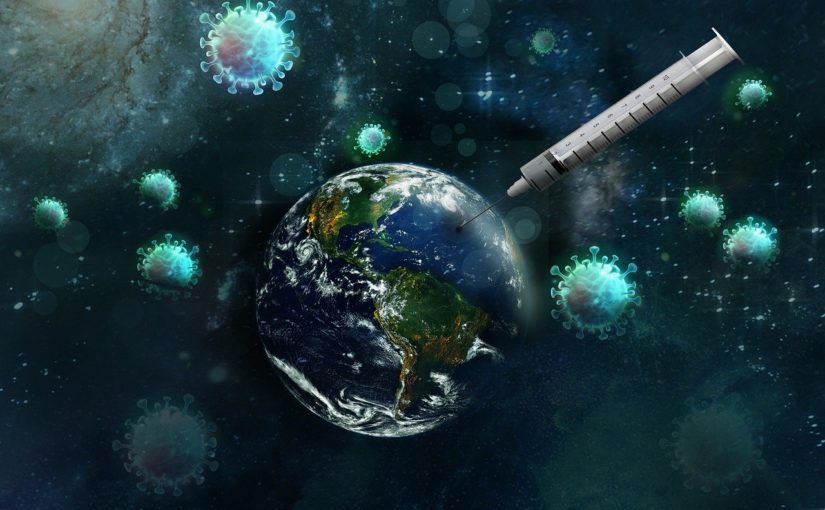Seit Januar 2025 erhalten alle GKV-Versicherte in Deutschland automatisch eine elektronische Patienten-Akte (ePA) von ihrer Krankenkasse. Hausärztinnen und Hausärzte sind nach der Einführungs- und Testphase gesetzlich verpflichtet, diese mit bestimmten Daten zu befüllen, die im Rahmen der aktuellen Behandlung der Patientinnen und Patienten erhoben werden (§ 347 Abs.1 SGB V).
nur schleppend angenommen
Wie die Rheinische Post am 21.7.2025 meldete, wird die ePA von den Patient:innen nur schleppend angenommen. Für wichtige Gesundheitsdaten wie Untersuchungsbefunde und Laborwerte haben die allermeisten gesetzlich Versicherten inzwischen auch eine elektronische Patientenakte (ePA). Millionen benutzen sie bisher aber noch nicht für sich selbst, um hineinzusehen oder sensible Angaben zu sperren. Der Hausärzteverband kritisierte deswegen hauptsächlich die Krankenkassen.
bessere Aufklärung nötig
Der ePA drohe eine Bruchlandung, so der Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Beier, in der Rheinuschen Post. Die Zahl der aktiven Nutzer sei ernüchternd. Er forderte eine bessere Aufklärung von Patientinnen und Patienten durch die Krankenkassen. Bislang hätten sich die Kassen darauf beschränkt, Briefe mit allgemeinen Informationen zu verschicken.
nicht alltagstauglich
Die elektronische Patientenakte sei in ihrer aktuellen Form schlichtweg nicht alltagstauglich, sagte der Hausärzte-Chef und verwies etwa auf einen aus seiner Sicht komplizierten Registrierungsprozess und störanfällige Technik.
Falls die ePA scheitert, wäre das gerade für die Patienten eine schlechte Nachricht. Eine gut umgesetzte ePA habe zweifellos das Potenzial, die Versorgung spürbar zu verbessern und zu vereinfachen.
GKV sieht erstklassige Arbeit der Kassen
Die Kassen sehen das natürlich anders. In einer Meldung vom 22.7.2025 betont der GKV-Spitzenverband, die Krankenkassen hätten erstklassige Arbeit geleistet, indem sie in kurzer Zeit termingerecht über 70 Millionen elektronische Patientenakten angelegt und die Versicherten darüber informiert hätten. Jetzt gehe es darum, die Akzeptanz und den praktischen Nutzen der ePA weiter zu erhöhen, damit sie tatsächlich in der Breite der Versorgung ankomme und diese verbessern könne.
nächster Schritt im Oktober
Der nächste große Schritt sei zum 1. Oktober geplant, denn ab dann seien alle Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, neue Diagnosen und Befunde in der elektronischen Patientenakte abzulegen.
Selbstversuch
Ich habe aufgrund dieser Meldungen ebenfalls versucht, meine persönliche ePA einmal anzuschauen. Vielleicht, so mein erster Gedanke, gehört für viele Menschen der Inhalt seiner ePA ja nicht gerade zu den aktuell drängendsten Problemen. Nun gut, reinschauen kann ich ja mal, vielleicht steht ja doch was drin, was ich noch nicht wusste. Oder was ich sperren könnte, obwohl ich auf Anhieb nicht weiß, was das bei mir sein könnte.
Also gut. Anmelden. Um die ePA zu nutzen, muss ich eine App installieren. Die fordert mich auf, erst die Krankenkassen-App zu installieren. Das geht relativ schnell, ich benutze die Zugangsdaten von meinem PC. Die hab ich schon länger. Dann wieder zurück zur ePA-App. Und hier muss ich erst einmal aufgeben. Da ich weniger der Smartphone-Mensch bin, benutze ich schon länger kein neueres Modell mehr. Fürs Telefonieren, Kurznachrichten, Online-Banking und die Uhrzeit reichte das bisher. Aber nicht für die ePA. Mein Smartphone sei nicht NFC-fähig. Ich muss also persönlich bei meiner Krankenkassen-Filiale erscheinen und mir die App freischalten lassen.
Jetzt muss ich an die – zugegebenen nur noch wenigen – Mitmenschen denken, die nicht über ein Smartphone verfügen und auch mit PCs kaum etwas anfangen können. Es gibt sie aber. Wir sollten sie nicht zurücklassen.
Quellen: Rheinische Post, Hausärzteverband, GKV, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: pixabay.com doctor-4187242_1280.jpg