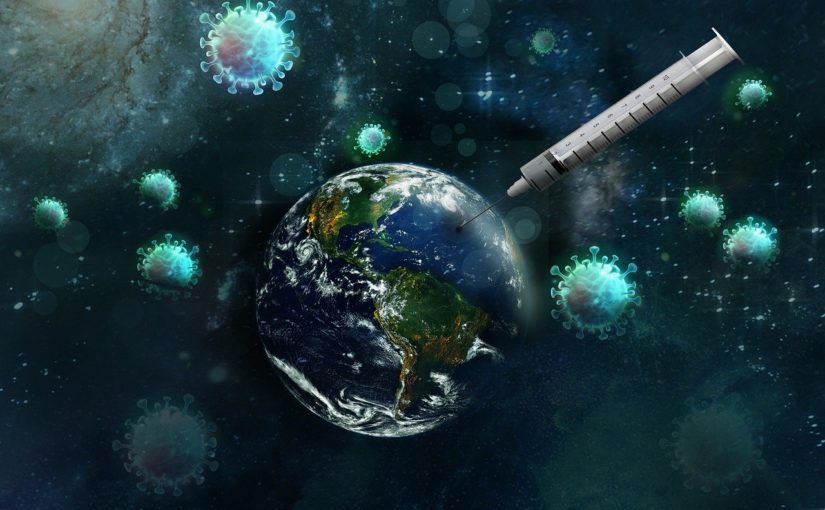Obwohl bei der Verwirklichung des Ziels 3.3 der nachhaltigen Entwicklung (SDG), die Epidemien von HIV, Tuberkulose (TB), Virushepatitis B und C sowie sexuell übertragbaren Infektionen (STI) bis 2030 zu beenden, Fortschritte erzielt wurden, ist die Europäische Union/Europäischer Wirtschaftsraum (EU/EWR) bei vielen Zielen vom Kurs abgekommen. Dies geht aus dem ersten Überwachungsbericht zu den SDGs hervor, der Mitte April 2025 vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) veröffentlicht wurde.
Vermeidbare Krankheiten
„Europa braucht mutige, koordinierte Maßnahmen in den Bereichen Prävention, Tests und Behandlung, um unsere SDG-Ziele für 2030 zu erreichen. Diese Krankheiten sind vermeidbar, ebenso wie die Belastung, die sie für Gesundheitssysteme, Patienten und ihre Familien bedeuten. Wir haben fünf Jahre Zeit zum Handeln; wir müssen sie nutzen“, sagte ECDC-Direktorin Pamela Rendi-Wagner.
Fortschritte bei der HIV-Testung und Behandlung
In der EU/EEA sind seit 2010 35 % weniger neue HIV-Infektionen gemeldet worden. Das Ziel für 2025 wird aber nicht erreicht. Es gibt gute Fortschritte bei der HIV-Testung und Behandlung. Aber es ist immer noch schwer, Menschen ohne Diagnose zu finden und sie zu versorgen. Die Nutzung von HIV-Vorbeugungsmitteln wie PrEP nimmt zu, aber es muss mehr davon gemacht werden. Seit 2015 hat es 35 % weniger Tuberkulose gegeben. Trotzdem werden weniger als 90 % der Tuberkulose-Erkrankungen behandelt, insbesondere bei arzneimittelresistenter Tuberkulose.
Todesfälle durch Hepatitis B und C
Virale Hepatitis B und C verursachen die meisten der jährlich fast 57 000 Todesfälle, die in der EU/im EWR auf AIDS, Tuberkulose und virale Hepatitis zurückzuführen sind. Bei Hepatitis B und C deuten die verfügbaren Informationen auf erhebliche Defizite bei der Erreichung der Test- und Behandlungsziele hin, und die Sterblichkeitsraten zeigen keine Anzeichen für einen Rückgang.
Sexuell übertragbaren Krankheiten
Die gemeldeten Fälle von sexuell übertragbaren Krankheiten wie Syphilis und Gonorrhöe nehmen in der gesamten EU/EWR zu und haben die höchsten Zahlen seit Beginn der Überwachung durch das ECDC im Jahr 2009 erreicht. Daten zur Test- und Behandlungsrate für STIs sind weitgehend nicht verfügbar, was das Gesamtbild erschwert.
Präventionsmaßnahmen ausweiten
Um die Ziele für 2030 zu erreichen, müssen Anstrengungen unternommen werden, um Präventionsmaßnahmen wie die PrEP für HIV, die Hepatitis-B-Impfung und Dienste zur Schadensbegrenzung für Menschen, die Drogen injizieren, auszuweiten und gleichzeitig den Gebrauch von Kondomen zu fördern. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, integrierte Testdienste für Mehrfachinfektionen in verschiedenen Umfeldern, einschließlich gemeindebasierter Tests, auszubauen, um Risikopersonen in einem früheren Stadium zu erreichen. Eine bessere Anbindung an die Versorgung und die Unterstützung der Therapietreue sind von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der individuellen Ergebnisse und die Verhinderung der Weiterübertragung, insbesondere bei Tuberkulose und Virushepatitis.
Verbesserung der Datenehebung
Eine Verbesserung der Qualität und Vollständigkeit der Überwachungs- und Kontrolldaten ist von entscheidender Bedeutung, ebenso wie die Erhebung von Daten, die sich auf die am stärksten von diesen Infektionen betroffenen Bevölkerungsgruppen beziehen. Um die Sterblichkeit durch vermeidbare Krankheiten zu senken, sind nachhaltige Anstrengungen erforderlich, und die Verbesserung der Verfügbarkeit und Qualität von Überwachungsdaten ist von grundlegender Bedeutung, um die Fortschritte genau zu verfolgen.
Quellen: UN, wikipedia, EU-European Centre for Disease Prevention and Control, Tagesschau
Abbildung: Von Samynandpartners – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46989619 Europa_building_February_2016.jpg