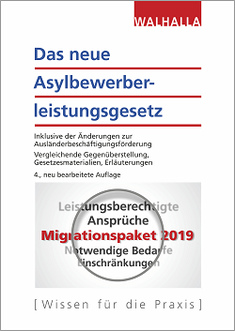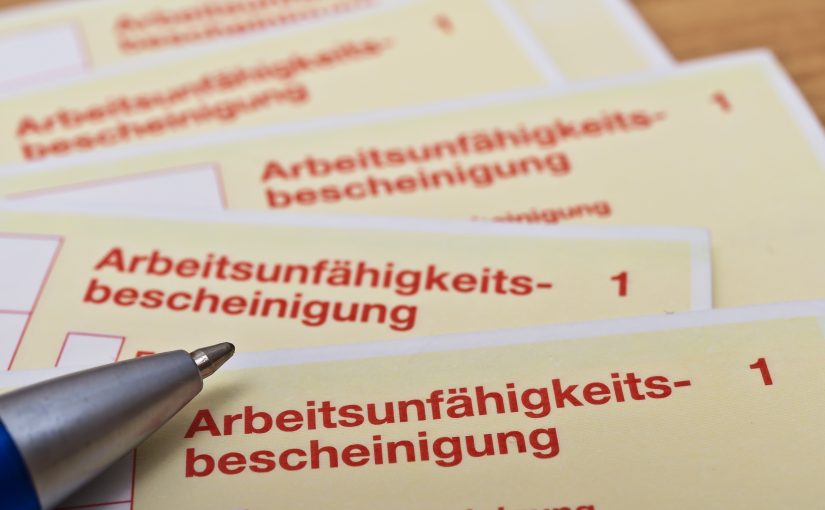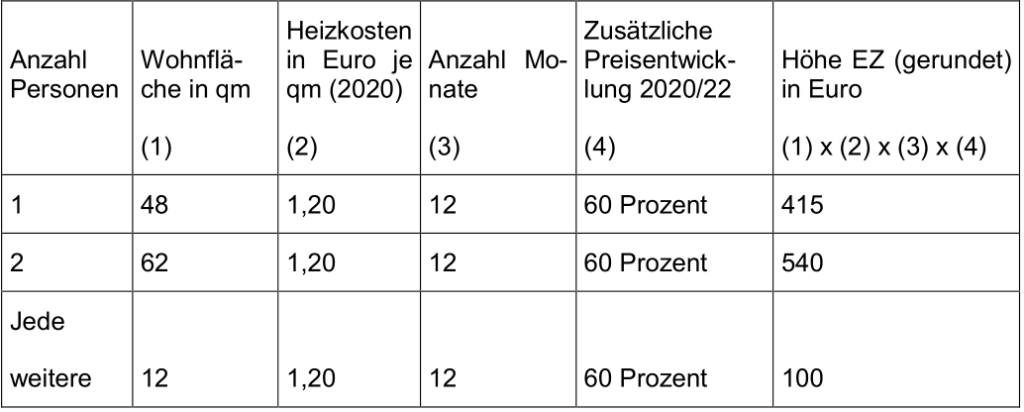Das „Achte Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“ bringt vor allem die Erleichterungen bei den Hinzuverdienstgrenzen für Rentner. Es ist ein sehr umfangreiches Gesetzespaket mit über 30 Artikeln und Änderungen in fast allen Sozialgesetzbüchern. Im Wesentlichen geht es um Datenaustausch und Digitalisierung in der Sozialversicherung.
Bevor das Gesetz endgültig im Bundesrat am 16. Dezember 2022 verabschiedet wird, hat die Regierungskoalition aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Arbeit noch zwei wichtige Änderungen eingebaut. Zum einen wurde eine Regelung aufgenommen, mit der gemäß der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts eine neue Bemessungsgrundlage beim Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld für Grenzgängerinnen und Grenzgänger geschaffen wird, sofern die Entgeltersatzleistung im Wohnsitzstaat der Grenzgängerinnen und Grenzgänger besteuert wird. Zum anderen enthält das Gesetz nun eine Regelung zur Entfristung des erleichterten Zugangs zum Arbeitslosengeld für überwiegend kurz befristet Beschäftigte.
Doppelbesteuerung
Mit der neuen Bemessungsregelung wird gesetzlich klargestellt, dass für Grenzgängerinnen und Grenzgänger in den Fällen, in denen das Besteuerungsrecht für die Entgeltersatzleistungen Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld im Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkommens dem Wohnsitzstaat zugebilligt wurde und dieser Staat das Besteuerungsrecht ausübt, das Kurzarbeitergeld bzw. Arbeitslosengeld ohne Abzug einer fiktiven deutschen Lohnsteuer zu berechnen ist.
Diese Regelung schreibt eine bereits aufgrund aktueller Rechtsprechung des Bundessozialgerichts geänderte Rechtsanwendung der Bundesagentur für Arbeit gesetzlich fest. Damit werden Doppelbelastungen der betroffenen Grenzgängerinnen und Grenzgänger verhindert.
Sonderreglung entfristet
Für überwiegend kurz befristet Beschäftigte wird der erleichterte Zugang zum Arbeitslosengeld festgeschrieben. Damit wird die bisher bis zum Ende des Jahres 2022 befristete Sonderreglung entfristet. Nach dieser Regelung kann ein Anspruch auf Arbeitslosengeld unter erleichterten Bedingungen geltend gemacht werden. Für diesen Personenkreis reichen bereits Versicherungspflichtzeiten von sechs Monaten innerhalb der letzten 30 Monate vor der Arbeitslosigkeit aus. Ansonsten müssen für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld Versicherungszeiten von 12 Monaten innerhalb des genannten Zeitraums vorliegen. Die Sonderregelung trägt den Besonderheiten von überwiegend kurz befristet Beschäftigten Rechnung. Dies sind oftmals Kunst- und Kulturschaffende.
Quelle: BMAS
Abbildung: webinar_sozialrecht_AdobeStock_83227398_600x600@2x.jpg