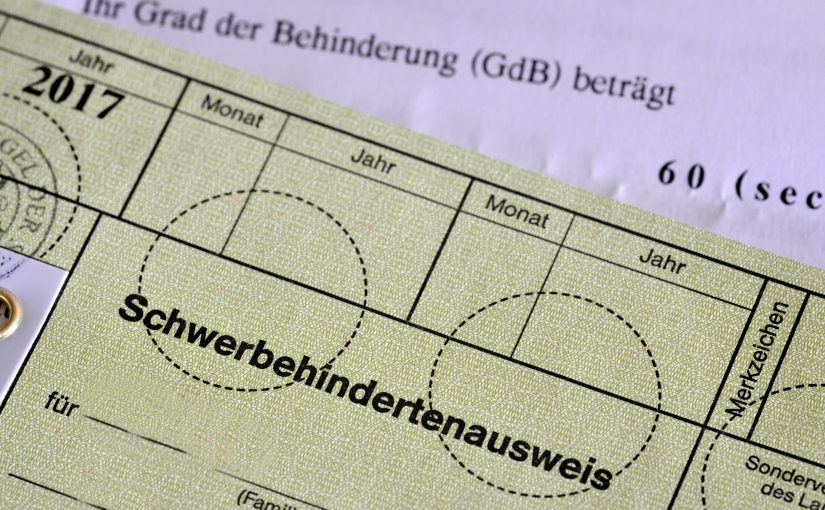Freiwillig geleistete Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zählen anders als Pflichtbeiträge für eine versicherte Tätigkeit nicht zu den Grundrentenzeiten.
Dies hat der 5. Senat des Bundessozialgerichts entschieden. (Aktenzeichen B 5 R 3/24 R).Die Ungleichbehandlung sei gerechtfertigt, urteilten die Richter. Der allgemeine Gleichheitssatz werde dadurch nicht verletzt. Im Gegensatz zu freiwillig Versicherten könnten sich Pflichtversicherte ihrer Beitragspflicht nicht entziehen. Sie trügen in der Regel durch längere Beitragszeiten und höhere Beiträge in wesentlich stärkerem Maße zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung bei.
Zwar könne auch bei freiwillig Versicherten die Situation eintreten, dass sie trotz langjähriger, aber geringer Beitragsleistung keine auskömmliche Altersversorgung aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben. In der Folge müssen sie bei bestehender Hilfebedürftigkeit im Alter gegebenenfalls Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch nehmen.
Dass der Gesetzgeber in erster Linie Versicherte begünstige, die langjährig verpflichtend Beiträge aus unterdurchschnittlichen Arbeitsverdiensten gezahlt haben, sei im Rahmen des Spielraums bei der Ausgestaltung der Rentenversicherung nicht zu beanstanden, argumentierte das Gericht.
Rentner klagte gegen Rentenversicherung
Geklagt hatte ein 77-jähriger Rentner aus Baden-Württemberg. Er wollte von der Deutschen Rentenversicherung einen Grundrentenzuschlag gewährt bekommen. Der Grundrentenzuschlag ist ein zusätzlicher Betrag zur gesetzlichen Rente, der an Rentnerinnen und Rentner gezahlt wird, die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten aufweisen.
Die Deutsche Rentenversicherung hatte den Antrag des Mannes abgelehnt mit der Begründung, dass dieser nicht die erforderlichen 33 Jahre mit Pflichtbeiträgen vorweisen könne. Konkret wurden dem Mann nur Zahlungen in 230 Monaten anerkannt, während 312 Monate freiwilliger Beitragszahlungen aus selbstständiger Tätigkeit unberücksichtigt blieben. Das Bundessozialgericht bestätigte die Entscheidung aus erster Instanz.
Quelle: PM des Bundessozialgerichtes vom 6. Juni 2025