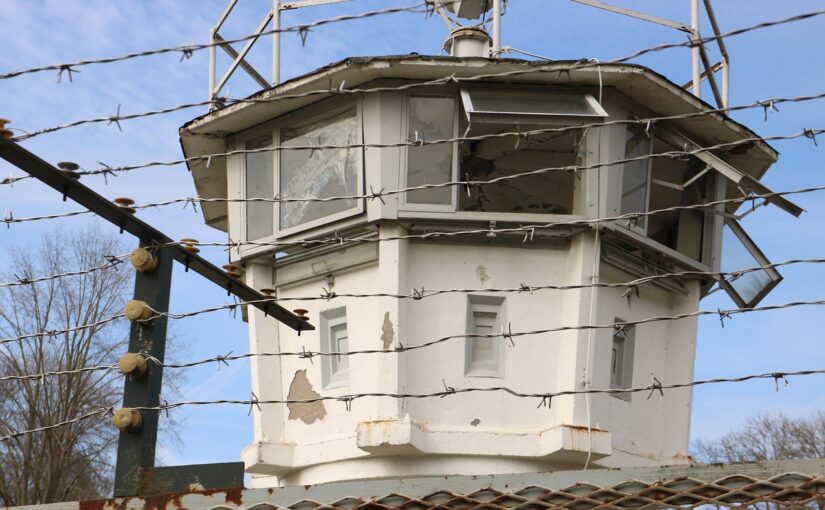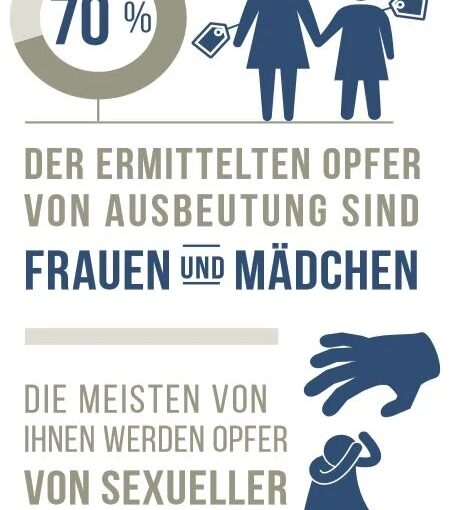Zum 18. Mal fand am 28. Februar 2025 weltweit der Rare Disease Day statt, der internationale Tag der Seltenen Erkrankungen. Auch der Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD) und der GKV-Spitzenverband erinnern daran.
Wann ist eine Erkrankung selten?
In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Es gibt allerdings mehr als 8.000 Seltene Erkrankungen und jährlich werden weitere entdeckt. Die Gesamtzahl der Betroffenen ist deshalb trotz der Seltenheit der einzelnen Erkrankung hoch. Allein in Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer Seltenen Erkrankung, in der gesamten EU geht man von circa 30 Millionen Betroffenen aus.
Viele Seltene Erkrankungen sind schwer zu erkennen und haben genetische Ursachen. Die Diagnosestellung ist entscheidend für die weitere Versorgung und Betreuung der erkrankten Menschen. Mit herkömmlichen Methoden ist dies nicht immer möglich.
Modellvorhaben im Rahmen des SGB V
Seit 2021 erlaubt der § 64e SGB V ein Modellvorhaben zur umfassenden Diagnostik und Therapiefindung mittels Genomsequenzierung sowohl bei seltenen als auch bei onkologischen Erkrankungen. Das Modellvorhaben Genomsequenzierung wird aktuell an 27 Spitzenzentren der Universitätsklinika durchgeführt, die hierfür gemeinsam einen Vertrag mit dem GKV-Spitzenverband geschlossen haben. Dies berichtet der GKV in einer Pressemitteilung anlässlich des Tags der Seltenen Erkrankungen.
umfangreichen Qualitätsanforderungen
Die umfangreichen Qualitätsanforderungen führen dazu, dass die Versorgung auf die Einrichtungen konzentriert wird, die in multidisziplinären Teams eine umfassende Expertise mit Seltenen Erkrankungen haben und bei denen Forschung und Versorgung Hand in Hand gehen. Damit wird gewährleistet, dass zielgerichtet die Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf eine Seltene Erkrankung ausgewählt werden, bei denen genetische Veränderungen als Ursache vermutet werden.
neue Therapiemöglichkeiten
Das Modellvorhaben verfolgt den Ansatz einer wissensgenerierenden Versorgung, bei der klinische und genomische Daten in einer gemeinsamen Dateninfrastruktur zusammengeführt und gleichzeitig für Ärztinnen und Ärzte sowie Forschende auswertbar gemacht werden. So können in Zukunft noch mehr Patientinnen und Patienten mit Seltenen Erkrankungen von dem Modellvorhaben profitieren, wenn durch die hier gewonnenen Erkenntnisse neue Therapiemöglichkeiten entwickelt werden. Auch die Evaluation des Modellvorhabens wird so ermöglicht.
Erste Erfolge
Mit der Genomsequenzierung steht nun das modernste und anspruchsvollste Verfahren zur Verfügung, um das Vorliegen einer Seltene Erkrankung mit einer genetischen Ursache zu untersuchen. So berichtet eines der teilnehmenden Zentren für Seltene Erkrankungen an einem Universitätsklinikum, dass bereits zu Beginn des Modellvorhabens bei drei von vier kritisch kranken Kindern auf der Kinder-Intensivstation durch die Genomsequenzierung Diagnosen gestellt werden konnten, die nicht nur maßgeblich die Behandlung beeinflusst, sondern auch den Angehörigen die lange Ungewissheit genommen haben.
Quellen: achse (Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen), GKV-Spitzenverband, BMG, tagesschau
Abbildung: AdobeStock_872404437-scaled.jpeg