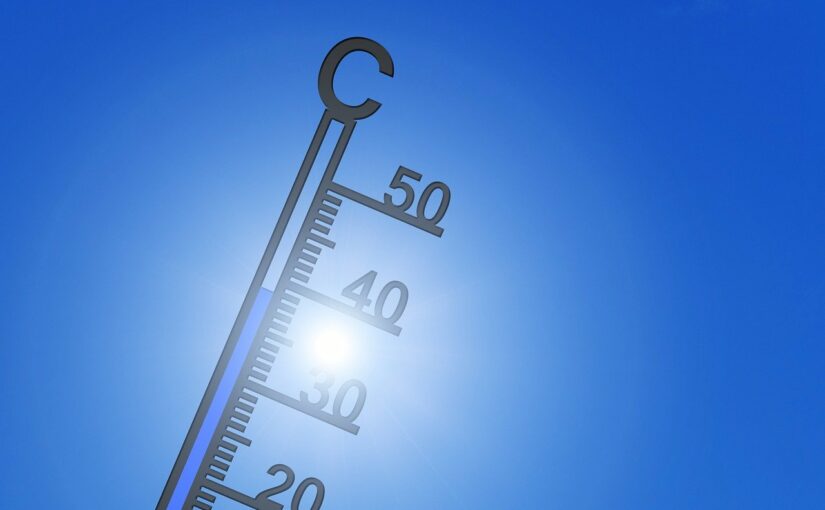Vorbemerkung: Dies ist mein 1000. Beitrag hier auf FOKUS-Sozialrecht – zu einem Thema, das mir besonders am Herzen liegt.
Dass die neue Wirtschaftsministerin meint, der Klimaschutz sei „in den letzten Jahren überbetont“ gewesen, lässt vor allem für unsere Kinder und Enkelkinder nichts Gutes von der neuen Bundesregierung erhoffen. Gut, dass sich vor einigen Wochen schon besorgte Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte an die Koalitionäre gewandt haben und den Schutz von Kindern vor den Folgen der Klimakrise einfordern.
Notfalldiagnose
In ihrem Schreiben stellen die Expertinnen und Experten für die körperliche, geistige und emotionale Entwicklung von Kindern eine Notfalldiagnose: Von Hitze und Extremwetter, der Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden, veränderten Ernährungs- und Mobilitätsbedingungen sowie neuen Infektionskrankheiten geht eine besondere Bedrohung für heranwachsende Generationen aus. Obwohl sie für die Klimakrise nicht verantwortlich sind, werden sie deren Folgen tragen müssen. Sowohl medizinischer Sachverstand als auch die UN-Kinderrechtskonvention gebieten demnach einen entschlossenen Einsatz für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und wirksame Klimaschutz-Maßnahmen. „Gesunde Kinder gibt es nur auf einer gesunden Erde“ – dazu sind jetzt zukunftsweisende politische Entscheidungen gefragt.
Positionspapier
In dem Brief verweist die Gruppe auf das von der AG Pädiatrie von KLUG – der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. – verfasste und von zahlreichen Fachgesellschaften, Verbänden, Organisationen und Einzelpersonen unterzeichnete Positionspapier „Kinder vor den Folgen der Klimakrise schützen“.
Konkrete Gesundheitsrisiken
Kinderärzte und medizinische Fachverbände (z.B. KLUG, BVKJ, AAP, WHO) warnen, dass der Klimawandel schwerwiegende, direkte und indirekte Gesundheitsrisiken für Kinder birgt, da diese physiologisch anfälliger sind als Erwachsene. Kinder sind aufgrund ihrer sich entwickelnden Organsysteme, höherer Stoffwechselraten (z.B. atmen sie pro Körpergewicht mehr Luft), weniger effizienter Thermoregulation, größerer Exposition gegenüber Schadstoffen (z.B. näher an bodennaher Verschmutzung) und Abhängigkeit von Bezugspersonen besonders anfällig. Säuglinge und Kleinkinder können ihren Wasserhaushalt nicht selbstständig regulieren, was bei hohen Temperaturen schnell zu Dehydrierung führt.
Die spezifischen gesundheitlichen Auswirkungen umfassen:
- Hitze und Extremwetterereignisse: Erhöhtes Risiko für Dehydrierung, Hitzschlag und andere hitzebedingte Erkrankungen. Krankenhausaufenthalte steigen während Hitzewellen. Auswirkungen während der Schwangerschaft: Hitzewellen sind mit Frühgeburten, Herzfehlbildungen, Totgeburten und niedrigem Geburtsgewicht verbunden. Extremwetter (Überschwemmungen, Stürme, Dürren) verursachen Verletzungen, Vertreibung und zerstören kritische Infrastruktur wie Häuser und Schulen.
- Luftverschmutzung: Kinder leiden unverhältnismäßig stark unter Feinstaub, bodennahem Ozon, Mikroplastik und anderen Schadstoffen. Dies führt zu Kopfschmerzen, Husten, Atembeschwerden, Entzündungsreaktionen, beeinträchtigtem Lungenwachstum und langfristigen systemischen Schäden (Herz-Kreislauf, neurologisch). Die Exposition schwangerer Frauen ist mit einem geringeren Geburtsgewicht verbunden. Durch den Klimawandel verschärfter Waldbrandrauch ist besonders schädlich und verursacht Asthmaanfälle und Atemwegsprobleme.
- Infektionskrankheiten: Der Klimawandel verändert Temperatur- und Niederschlagsmuster, was die Verbreitung und Übertragungssaison von vektorübertragenen Krankheiten (z.B. Lyme-Borreliose, Malaria, Dengue, Zika, Chikungunya) und wasserübertragenen Krankheiten (z.B. Durchfallerkrankungen durch kontaminiertes Wasser) begünstigt.
- Ernährungssicherheit und -versorgung: Klimafolgen wie Hitze, Dürre und Überschwemmungen führen zu Ernte- und Viehverlusten, beeinträchtigen den Zugang zu Nahrungsmitteln und erhöhen die Mangelernährung. Steigende CO2-Konzentrationen können den Nährstoffgehalt (Proteine, Zink, Eisen) in Grundnahrungsmitteln reduzieren.
- Chemikalien und Kontaminanten: Bedenken bestehen hinsichtlich endokriner Disruptoren (aus Kunststoffen), PFAS und Glyphosat, die die Fortpflanzungsfähigkeit, Entwicklung beeinträchtigen und langfristige Krankheitsrisiken erhöhen, insbesondere für ungeborene und junge Kinder. Auch die Wasserverunreinigung mit Nitraten, Pharmazeutika und Mikroplastik stellt ein Risiko dar.
- Psychische Gesundheit: Extremwetterereignisse verursachen Traumata, die zu posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Angstzuständen und Aggressionen führen können. Zukunftsängste („Öko-Angst“) nehmen zu; 80% der Kinder machen sich Sorgen um ihre Zukunft aufgrund der Klimakrise. Zwangsmigration verschärft den psychosozialen Stress.
- Zugang zur Gesundheitsversorgung: Der Klimawandel beeinträchtigt die Gesundheitsversorgung durch beschädigte Infrastruktur, Stromausfälle (die medizinische Geräte und Impfstofflagerung betreffen) und Engpässe in der Lieferkette.
Verletzung der Kinderrechte
Kinderrechtsorganisationen wie UNICEF und Save the Children betonen, dass die Klimakrise eine direkte Verletzung der in der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) verankerten Rechte darstellt und globale Ungleichheiten verschärft. Obwohl die 1989 verabschiedete UN-KRK den Klimawandel nicht explizit vorhersah, sind ihre Prinzipien heute unmittelbar bedroht. Der UN-Kinderrechtsausschuss und die UN-Generalversammlung haben das Menschenrecht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt inzwischen anerkannt. Untätigkeit von Regierungen und Unternehmen wird mittlerweile als Kinderrechtsverletzung betrachtet.
Besonders betroffen sind grundlegende UN-KRK-Artikel wie Artikel 3 (Kindeswohl), Artikel 6 (Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung), Artikel 12 (Recht auf Beteiligung), Artikel 24 (Recht auf Gesundheit), Artikel 27 (Recht auf einen angemessenen Lebensstandard) und Artikel 29 (Bildungsziele, einschließlich Respekt vor der Natur).
Globale Ungerechtigkeit
Die globale Ungerechtigkeit der Klimakrise zeigt sich darin, dass fast jedes Kind weltweit (99%) mindestens einer Klimaauswirkung ausgesetzt ist und eine Milliarde Kinder als „extrem stark gefährdet“ gelten. Kinder im Globalen Süden sind unverhältnismäßig stark betroffen; sie leben in Ländern, die minimal zu den globalen CO2-Emissionen beitragen, aber die höchsten Risiken tragen. So sind 33 Länder, die nur 9% der weltweiten CO2-Emissionen verursachen, für Kinder „extrem risikoreich“. Zwischen 2016 und 2021 wurden über 43 Millionen Kinder aufgrund wetterbedingter Katastrophen vertrieben. Ein Kind, das 2020 geboren wurde, wird im Durchschnitt fast siebenmal so viele Hitzewellen erleben wie die Generation seiner Großeltern.
Lösungsvorschläge
Kinderrechtsorganisationen und Kinderärzte sind sich einig in ihrem dringenden Appell für umfassende, systemische und sozial gerechte Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Auswirkungen.
Die vorgeschlagenen Lösungen beider Gruppen sind vielfältig und umfassen:
- Minderung: Drastische Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Übergang zu erneuerbaren Energien, Beendigung der Nutzung fossiler Brennstoffe.
- Anpassung: Aufbau klimaresilienter Gesundheitssysteme, Umsetzung von Hitze- und UV-Schutzmaßnahmen, Sicherstellung des Zugangs zu sauberem Wasser und gesunden Lebensmitteln.
- Bildung und Beteiligung: Stärkung von Kindern und Jugendlichen, Integration von Klima- und Gesundheitsbildung, Förderung der Selbstwirksamkeit.
- Umweltschutz: Verbesserung der Luftqualität, Schutz der Biodiversität, Vermeidung von Umweltverschmutzung.
- Soziale Gerechtigkeit: Bekämpfung globaler und nationaler Ungleichheiten, die durch den Klimawandel verschärft werden, und Sicherstellung, dass die Schwächsten geschützt und in Lösungen einbezogen werden.
Die übergreifende Botschaft ist klar: Ein gesunder Planet ist eine grundlegende Voraussetzung für gesunde Kinder und die vollständige Verwirklichung ihrer Rechte.
Quellen: Focus-online, Tagesschau, Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit (KLUG), wikipedia, unicef, American Academy of Pediatrics,
Abbildung: privat