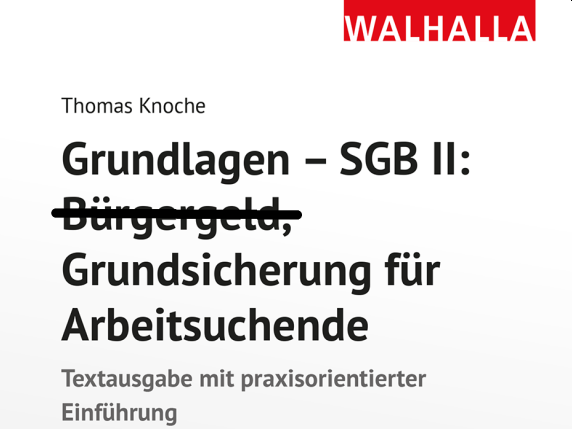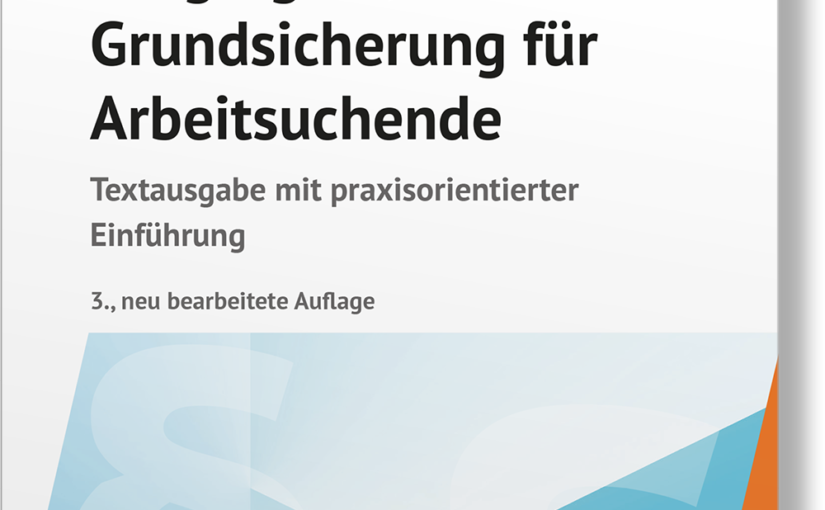Die schwierige – vorläufige – Einigung der Ampel auf einen Haushalt 2025 wird in einem gemeinsamen vom Bundesfinanzministerium herausgegebenem Papier mit dem euphorischen Titel: „Wachstumsinitiative – neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland“ beschrieben.
Einschränkungen beim Bürgergeld
Darin finden sich unter der Überschrift „Dynamisierung durch bessere Arbeitsanreize und mehr Fachkräfte“ die geplanten, bzw. vorgeschlagenen Änderungen beim Bürgergeld. Dahinter verbürgen sich, so der Paritätische Gesamtverband, deutliche Einschränkungen für Bürgergeldbeziehende. Wesentliche Anliegen der Bürgergeldreform – vertrauensvoller Umgang mit den Leistungsberechtigten und Stärkung der Förderung und Qualifizierung für eine nachhaltige Integration in Erwerbsarbeit – würden nunmehr wieder zurückgenommen. So würden Sanktionen wieder deutlich verschärft, die Zumutbarkeit in Bezug auf Pendelzeiten verändert und die Karenzzeiten beim Schonvermögen wieder reduziert. Zudem drohten durch die Haushaltsplanungen massive Einschnitte bei der Arbeitsförderung.
Inhalt des Kompromisspapiers der Koalition
Um die „Akzeptanz der Leistungen zu erhalten“ und um mehr Betroffene in Arbeit zu bringen, sei es erforderlich, heißt es im Ampel-Papier, das Prinzip der Gegenleistung wieder zu stärken:
Zumutbarkeit
Die Regelungen für die Zumutbarkeit von angebotener Arbeit sollten
zeitgemäß überarbeitet werden. Dies gilt zum Beispiel für den Weg zur Arbeit.
So sollte ein längerer Weg zur Arbeit als zumutbar gelten und eine tägliche
Pendelzeit von 2 ½ Stunden bei einer Arbeitszeit von bis zu sechs Stunden
und von drei Stunden bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden in Kauf
genommen werden müssen. Zudem sollte per BA-Weisung deutlich
konkretisiert werden, dass auch weitere Fahrtwege zum Arbeitsplatz als
unbedingt zumutbar gelten. Die Jobcenter sollen in einem Umkreis von 50 km
zwischen Wohn- und Arbeitsort nach einem Arbeitsplatz suchen. Die Regeln
zum Umzug im Sozialgesetzbuch II (SGB II) werden analog zu den Regeln im
Sozialgesetzbuch III (SGB III) angepasst. Bei allen genannten Maßnahmen
sollten Ausnahmen für Personen mit Kindern oder pflegebedürftigen
Angehörigen berücksichtigt werden. Die vorgenannten Regelungen werden
gesetzgeberisch klargestellt.
Mitwirkungspflichten
Gegenleistungsprinzip bedeutet auch, dass die Konsequenzen bei fehlender
Mitwirkung verschärft werden. Wer eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder
Eingliederungsmaßnahme ohne triftigen Grund ablehnt, wird mit erhöhten
Kürzungen des Bürgergeldes rechnen müssen. Deshalb wird die Bundesregierung eine einheitliche Minderungshöhe und -dauer von 30 Prozent für drei Monate einführen. Bei Meldeversäumnis kann eine Minderungshöhe von 30 Prozent für einen Monat festgesetzt werden. Dabei wird es keine starre Sanktionsdauer geben, sondern gelten, dass bei positiver Mitwirkung (oder Signal der Mitwirkungsbereitschaft) die Sanktion aufgehoben wird. Eine hohe, verbindliche Kontaktdichte zwischen Beziehern von Bürgergeld und Behörden ist wichtig für Vermittlungserfolge, insbesondere für diejenigen, die kurzfristig dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen (also z.B. nicht Personen in Fortbildungsmaßnahmen, mit Erziehungspflichten etc.). Um den Vermittlungserfolg zu erhöhen, werden für diesen Personenkreis besondere Meldeverpflichtungen etabliert. Leistungsbeziehende dieses Personenkreises sollen sich monatlich in Präsenz bei der zuständigen Behörde melden müssen. Die Meldung ist mit dem geringstmöglichen Verwaltungsaufwand zu organisieren. Zudem muss künftig sofort mit einer 30-prozentigen Leistungskürzung rechnen, wer wegen einer Sperre im Arbeitslosengeld I ins Bürgergeld rutscht.
Schwarzarbeit
Die Bundesregierung wird die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, damit die Jobcenter Schwarzarbeit als Pflichtverletzung ahnden und Leistungskürzungen vornehmen können (30 Prozent für drei Monate).
Um zu verhindern, dass viele Verfahren des Sozialleistungsbetrugs wegen
Geringfügigkeit und hoher Überlastung der Staatsanwaltschaften eingestellt
werden, wird im Rahmen des geplanten Gesetzgebungsverfahrens zur
Modernisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung die Zuständigkeit der sog.
Kleinen Staatsanwaltschaft der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS)
künftig auf Fälle des Sozialleistungsbetruges erweitert werden. Weiterhin werden damit die Jobcenter verpflichtet, Verdachtsfälle von Leistungsmissbrauch und Schwarzarbeit an die FKS zu melden.
Karenzzeit beim Schonvermögen
Die Karenzzeit nach § 12 Abs. 3 und 4 SGB II auf sechs Monate verkürzt. Das Bürgergeld dient als existenzsichernde Leistung und ist nicht dafür da, das Vermögen einzelner abzusichern. Vermögen sollte grundsätzlich für den eigenen Lebensunterhalt eingesetzt werden, bevor Bürgergeld beansprucht werden kann. Altersvorsorge wird weiterhin nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 SGB II nicht als Vermögen berücksichtigt.
1 Euro Jobs
Das Instrument der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II soll eine Brücke
in den regulären Arbeitsmarkt darstellen. Dies ist insbesondere für Personen
von besonderer Bedeutung, die sich Maßnahmen immer wieder verweigern
(Totalverweigerer). Bei dieser Personengruppe kann der schrittweise Einstieg
in den Arbeitsmarkt damit befördert werden.
Strafrecht?
Harald Thome von tacheles e.V. kommentiert das „Wachstums“-Papier so: „…Im Kern soll hier das Sozialrecht in ein Strafrecht umgewandelt werden. Es ist für diese Regierung tatsächlich armselig, dass sie sich von der FDP, CDU bis zur AfD derart vor sich hertreiben lässt.“
Quellen: BMF, Paritätischer Gesamtverband, Tacheles e.V.
Abbildung: Walhalla Verlag: Buergergeld.png