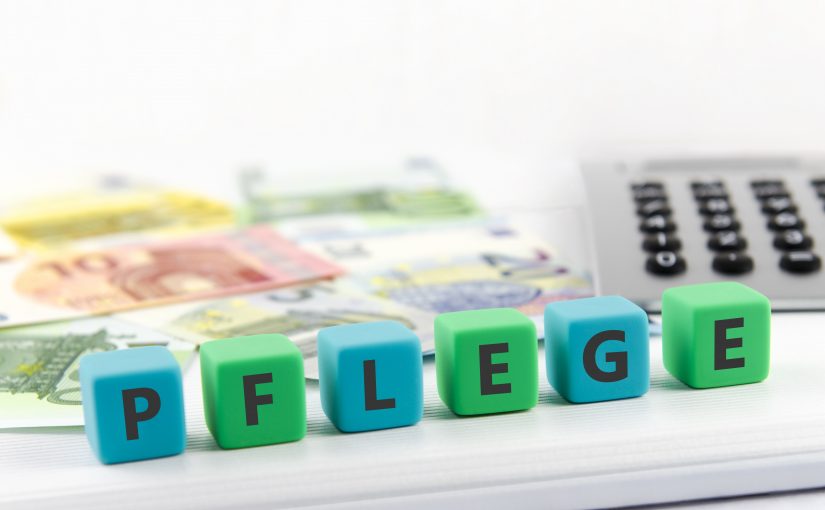Wie berichtet, hat der Bundesrat wegen fachfremder Regelungen zur Krankenhausfinanzierung im geplanten Pflegekompetenzgesetz („Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP)“) dieses in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Dieser berät darüber am 17.12.25, zwei Tage später gibt es dann einen neuen Versuch im Bundesrat. Man kann aber davon ausgehen, dass die zum 1.1.2026 geplanten Neuregelungen im SGB XI im nächsten Jahr auch umgesetzt werden, eventuell mit etwas Verspätung oder rückwirkend.
Neue Versorgungsform
Eine Neuregelung beinhaltet die geplante neue Versorgungsform des § 45h SGB XI: Leistungen in gemeinschaftlichen Wohnformen, bekannt geworden unter dem Kofferwort „stambulant“. Der Begriff „stambulant“ beschreibt eine Mischform zwischen ambulanter und stationärer Pflege — also weder klassische häusliche Pflege (ambulant), noch konventionelle Pflege im Heim (stationär), sondern eine alternative Versorgungsform.
Kernidee
Pflegebedürftige wohnen in kleineren, gemeinschaftlichen Wohngemeinschaften oder Hausgemeinschaften — mit eigenem Zimmer, eigener Wohnungsgestaltung, Gemeinschaftsbereichen etc. — und erhalten gleichzeitig eine durchgehende Betreuung und Pflege vor Ort, vergleichbar mit stationärer Pflege, aber mit dem Alltag und der Selbstbestimmung wie in einem Wohnumfeld.
Pflegebedürftige in gemeinschaftlichen Wohnformen mit Verträgen zur pflegerischen Versorgung gemäß § 92c erhalten einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 450 Euro je Kalendermonat zur Sicherstellung einer selbstbestimmten Pflege.
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben zudem je Kalendermonat Anspruch auf körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung als Sachleistung gemäß § 36. Zudem steht den Pflegebedürftigen für den nicht genutzten Teil des Sachleistungsanspruchs anteiliges Pflegegeld gemäß § 38 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37 zu.
Weitere Leistungen
Pflegebedürftige aller Pflegegrade haben außerdem Anspruch auf
- Pflegeberatung gemäß § 7a,
- Pflegehilfsmittel gemäß § 40 Absatz 1 und 2,
- digitale Pflegeanwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen bei der Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen gemäß den §§ 39a, 40a und 40b,
- zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung gemäß
§ 44a, - Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen gemäß § 45.
Kritik
Mehrere Sozial- und Fachverbände sowie Interessenvertretungen äußern größere Vorbehalte gegenüber dem Konzept „stambulant“ und seiner gesetzlichen Verankerung. Wichtige Kritikpunkte:
- Der Sozialverband Deutschland (SoVD) spricht sich gegen die Einführung einer dritten Säule („stambulant“ neben ambulant und stationär) aus. Man befürchtet eine neue Mehrklassenversorgung: Menschen mit wenig Einkommen oder ohne Angehörige könnten benachteiligt werden.
- Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege (BAH) fürchtet, dass das neue Konzept die bestehende Landschaft ambulant betreuter Wohngemeinschaften verdrängen könnte — insbesondere wenn die Finanzierung und Vergütung der neuen Form gegenüber bestehenden unterschiedlich oder ungünstig ausgestaltet ist.
- Der Versuch, mit stambulant eine Mischform gesetzlich zu verankern, so die BAH, könnte zu hohem bürokratischen Aufwand, Regulierungskomplexität und Unklarheiten in Zuständigkeiten führen — was sowohl für Anbieter als auch für Pflegebedürftige problematisch sein kann.
- Der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV) kritisiert, dass der monatliche Zuschuss von 450 € zu niedrig sein könnte, um eine stabile und hochwertige Versorgung, insbesondere bei höherem Pflegebedarf, sicherzustellen.
Schließlich gibt es prinzipielle Kritik daran, mit dem dritten Sektor nicht das Grundproblem der Versorgungssegregation (ambulant vs. stationär) aufzulösen, sondern das System noch komplexer zu machen. Die Forderung vieler Verbände ist stattdessen eine Stärkung bewährter, flexibler und bedarfsorientierter Pflegeformen, ohne neue starre Kategorien zu schaffen.
Quellen: Bundesrat, FOKUS-Sozialrecht, SoVD, BAH, PKV
Abbildung: AdobeStock_235656439jpeg