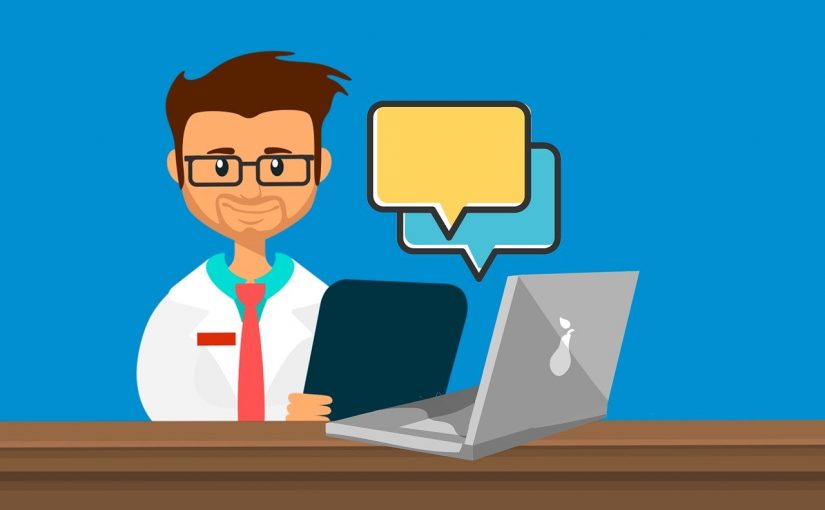Das Familienministerium hat Eckpunkte zur Digitalisierung von Familienleistungen vorgelegt. Schwerpunkt ist die Bündelung von vier Leistungen in einem Kombinierten Antrag:
- Geburtsanzeige,
- Kindergeld nach dem EStG,
- Elterngeld und
- für Familien mit kleinen Einkommen Kinderzuschlag.
Gesetzlicher Auftrag aus dem Jahr 2017
Grundlage ist das Onlinezugangsgesetz (OZG) – „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ aus dem Jahr 2017. Dieses war Teil eines umfangreichen Gesetzespakets, dem „Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“.
Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet die Regierung, bis zum Jahr 2022 sämtliche Leistungen der Verwaltung auch digital anzubieten. Ziel ist, Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und schneller zu gestalten und Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zu entlasten. So sollen Standardinformationen möglichst nur einmal mitgeteilt werden müssen. Eine Vereinfachung der Antrags- und Bearbeitungsprozesse soll durch die Nutzung des einwilligungsbasierten Datenaustausches geschaffen werden.
Test-Projekte
Wie das Familenministerium berichtet gab es schon diverse Testläufe. So zum Beispiel das Projekt ElterngeldDigital in einigen Bundesländern. Darauf aufbauend soll der digitale Antragsassistent KinderzuschlagDigital eingerichtet werden, dessen Umsetzung für 2020 geplant ist.
Mit dem Angebot „Kinderleicht zum Kindergeld“ testet die Freie und Hansestadt Hamburg gemeinsam mit der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit einen weiteren digitalen Piloten, mit dem die Eltern nach der Geburt ihres Kindes in einem Schritt den Namen ihres Kindes bestimmen, zusätzliche Geburtsurkunden und das Kindergeld nach dem EStG beantragen können.
Gesetzliche Grundlagen erforderlich
Für all dies müssen aber die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, beziehungsweise angepasst werden.
Um zu erreichen,
- dass eine kombinierte Beantragung der oben genannten vier Leistungen mit Hilfe einer einheitlichen Online-Anwendung möglich ist und
- dass Bürgerinnen und Bürger für diese unterschiedlichen Anträge die notwendigen Nachweise möglichst nicht selbst beibringen müssen sondern sich einverstanden erklären können, dass die verantwortlichen Stellen die erforderlichen Daten selbst per Einzel- oder automatischem Registerabruf beiziehen, unter Wahrung des Datenschutzes,
bedarf es der ‚Änderung einiger Gesetze:
- Ermöglichung des einwilligungsbasierten, bereichsspezifischen Datenabrufs – insbesondere durch Schaffung von Rechtsgrundlage,
- Regelungen zur Nutzung des bereits gesetzlich normierten rvBEA-Verfahrens für den Abruf von Entgeltdaten bei den Arbeitgebern auch für Elterngeld und Kinderzuschlag (SGB IV),
- Regelungen zum elektronischen Datenaustauch zwischen Elterngeldstellen, Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit und gesetzlichen Krankenkassen (SGB V)
- Notwendige Anpassungen in den jeweiligen Fachgesetzen wie Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) und Bundeskindergeldgesetz (BKGG).
Papier-Anträge sind weiter möglich
Das digitale Antragsverfahren soll ein zusätzliches Angebot neben den bereits bestehenden Beantragungsmöglichkeiten dieser Leistungen sein.
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wollen einen entsprechenden Gesetzentwurf bis März 2020 vorlegen.
Quelle: Bundesfamilienministerium
Abbildung: pixabay.com anaterate2.jpg