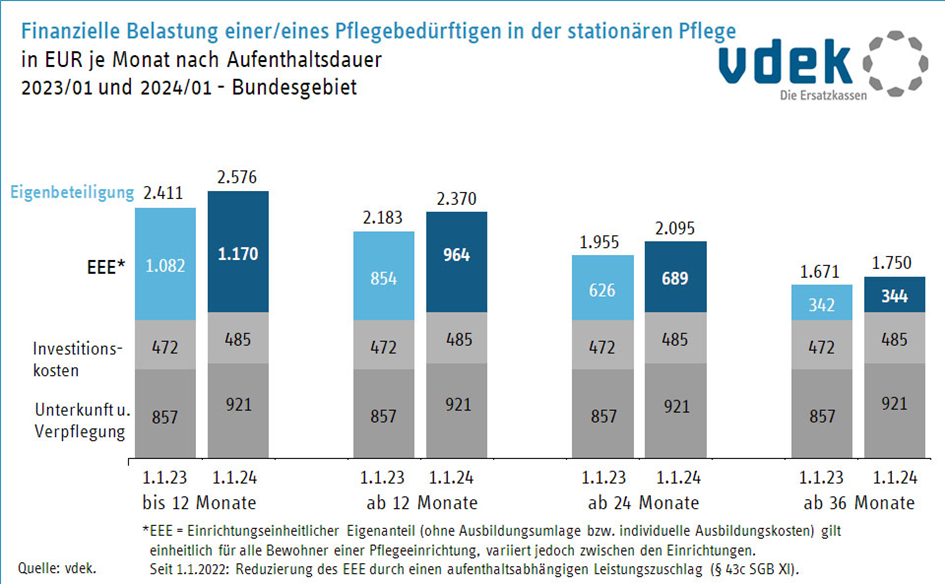Nach § 30 SGB XI steigen Beträge für die Leistungen der Pflegeversicherung zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent. Es geht um alleim Vierten Kapitel SGB XI aufgeführten Leistungen. Das Bundesgesundheitsministerium hat die Beträge nun vorab veröffentlicht. Die vorgesehene formale Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolge in Kürze.
Pflegesachleistung
(§ 36 Absatz 3 SGB XI)
| bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 | |
| Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € |
| Pflegegrad 2 | 761 € | 796 € |
| Pflegegrad 3 | 1.432 € | 1.497 € |
| Pflegegrad 4 | 1.778 € | 1.859 € |
| Pflegegrad 5 | 2.200 € | 2.299 € |
Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen
(§ 37 Absatz 1 Satz 3 SGB XI)
| | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
| Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € |
| Pflegegrad 2 | 332 € | 347 € |
| Pflegegrad 3 | 573 € | 599 € |
| Pflegegrad 4 | 765 € | 800 € |
| Pflegegrad 5 | 947 € | 990 € |
Tagespflege und Nachtpflege
(§ 41 Absatz 2 Satz 2 SGB XI)
| | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
| Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € |
| Pflegegrad 2 | 689 € | 721 € |
| Pflegegrad 3 | 1.298 € | 1.357 € |
| Pflegegrad 4 | 1.612 € | 1.685 € |
| Pflegegrad 5 | 1.995 € | 2.085 € |
Vollstationäre Pflege
(§ 43 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 SGB XI)
| | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
| Pflegegrad 1 | 125 € | 131 € |
| Pflegegrad 2 | 770 € | 805 € |
| Pflegegrad 3 | 1.262 € | 1.319 € |
| Pflegegrad 4 | 1.775 € | 1.855 € |
| Pflegegrad 5 | 2.005 € | 2.096 € |
Für alle Pflegegrade erhöhen sich jeweils folgende Leistungen:
- Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen (§ 38a Absatz 1 Satz 1 SGB XI) – von 214 € auf 224 €.
- Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (§ 40 Absatz 2 Satz 1 SGB XI) – von 40 € auf 42 €.
- Leistungsanspruch beim Einsatz digitaler Pflegeanwendungen (§ 40b Absatz 1 SGB XI) – von 50 € auf 53 €.
- Entlastungsbetrag (§ 45b Absatz 1 Satz 1 SGB XI) – von 125 € auf 131 €.
- Berechnung und Zahlung des Heimentgelts gemäß § 87a Absatz 4 Satz 1 SGB XI (Betrag bei Rückstufung des Pflegebedürftigen) von 2.952 € auf 3.085 €.
- Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40 Absatz 4 Satz 2 bis 4 SGB XI) – von 4.000 € auf 4.180 €. Maximaler Gesamtbetrag je Maßnahme zur Verbesserung des gemeinsamen Wohnumfeldes – von 16.000 € auf 16.720 €.
- Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen (§ 45e
Absatz 1 Satz 1 und 2 SGB XI) – 2.500 € auf 2.613 €. Maximaler Gesamtbetrag je Wohngruppe – von 10.000 € auf 10.452 €.
Für Pflegegrade 2 bis 5 erhöhen sich jeweils folgende Leistungen:
- Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson (§ 39 Absatz 1 Satz 3 SGB XI) – von 1.612 € auf 1.685 €.
- Kurzzeitpflege, Leistungsbetrag gemäß § 42 Absatz 2 Satz 2 SGB XI – von 1.774 € auf 1.854 €.
Leistungsbetrags – Übertragung
Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson, Leistungsbetrags – Übertragungsmöglichkeit gemäß § 39 Absatz 2 SGB XI. Der Leistungsbetrag kann um bis zu 843 € (2024: 806 €) aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege auf insgesamt bis zu 2.528 € im Kalenderjahr erhöht werden. (2024: 2.418 €)
Quelle: BMG
Abbildung: Fotolia_131963391_Subscription_XL.jpg