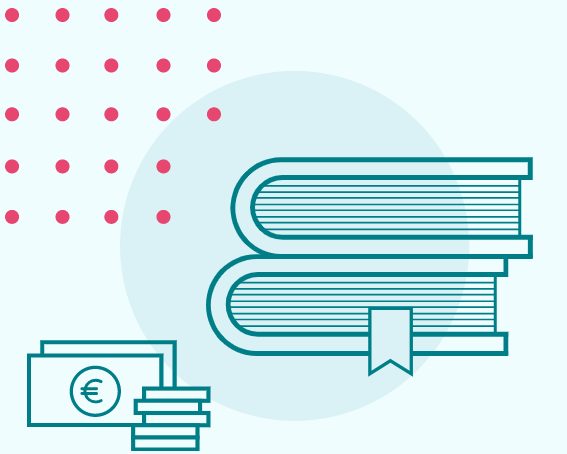Die 27. BAFöG Reform ist seit 1. August 2022 in Kraft. Die finanziellen Verbesserungen und andere Änderungen wurden hier schon ausführlich beschrieben. Ebenso die tatsächliche Umsetzung im Vergleich zu den Ankündigungen im Koalitionsvertrag.
BAFöG – Digital
Eine der Neuerungen betrifft die Möglichkeit, BAFöG nun komplett digital zu beantragen. Geplant war das schon länger und es wurde in einigen Bundesländern seit Herbst 2021 getestet.
Mit dem Wegfall des bislang für die Antragstellung in § 46 BAföG vorgesehenen Schriftformerfordernisses wird sowohl die analoge als auch die digitale Antragstellung erleichtert. Künftig ist eine elektronische Antragstellung ohne Originalunterschrift oder schriftformersetzende aufwändige Authentisierungsverfahren möglich. Bei Nutzung des elektronischen Antragsassistenten BAföG Digital kann mit Anlegen eines einfachen Nutzerkontos ein digitaler Antrag auf Förderung nach dem BAföG unmittelbar rechtswirksam gestellt werden. Ausdrucken und Unterschreiben des Antrags ist nicht mehr erforderlich. Daraus ergeben sich spürbare Vollzugserleichterungen auch für die zuständigen Ämter für Ausbildungsförderung, da sich weitere Nachforderungen von Unterschriften bei elektronisch eingereichten Anträgen erübrigen.
Alternative: schriftlich per Post oder Email
Mit der Neuformulierung der Antrags-Vorschrift (§ 46 BAföG) wird künftig sowohl eine digitale Antragstellung über einen Online-Antragsassistenten wie „BAföG-Digital“ ohne Originalunterschrift oder schriftformersetzende aufwändige Authentisierungsverfahren möglich, als auch eine Antragstellung über eine E-Mail, der ein handschriftlich oder elektronisch ausgefüllter BAföG-Antrag z. B. als pdf oder als jpeg beigefügt ist. Da für die Antragstellung weiterhin die BAföG-Formblätter zu verwenden sind, wird der Beweissicherungsfunktion im Antragsverfahren ebenso hinreichend Rechnung getragen, wie der Warnfunktion, die den Antragstellenden bewusstmacht, dass sie im Begriff sind, eine rechtsverbindliche Erklärung abzugeben, die wahrheitsgemäß erfolgen muss und widrigenfalls bußgeld- oder unter Umständen auch strafbewehrt ist.
Beiträge zur Krankenversicherung
Grundsätzlich gilt: Gesetzlich versicherte Studenten sind bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres beitragsfrei über die Familienversicherung der Eltern krankenversichert.
Die gesetzliche Sonderregelung über die Versicherungspflicht von Studenten während ihres Studiums findet sich im § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V. Wer als Student nicht mehr beitragsfrei in der Familienversicherung krankenversichert ist oder wenn die Eltern als Selbständige oder Beamte privat versichert sind, muss der studentischen Krankenversicherung beitreten.
Beitrag richtet sich nach dem aktuellen Höchstsatz
Der Krankenkassenbeitrag für Studenten richtet sich nach dem BAföG-Höchstsatz. Steigt dieser, steigen auch die Kosten für die Krankenversicherung.
Der aktuelle Beitrag zur studentischen Krankenversicherung ab Wintersemester 2022/2023 beträgt 82,99 EUR.
Beiträge studentische Kranken und Pflegeversicherung ab Wintersemester 2022/2023:
| 1. Krankenversicherung | 82,99 EUR |
| 2. durchschnittlicher Zusatzbeitrag* | 10,56 EUR |
| 3. Pflegeversicherung | 24,77 EUR |
| 4. Pflegeversicherung für Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr | 26,80 EUR |
| möglicher höchster Gesamtbeitrag (Summe der Zeilen 1,2,4) | 120,34 EUR |
Zuschüsse bei freiwilliger Versicherung
Die studentische Krankenversicherung endet zum Ende des Semesters, in dem der Student das 30. Lebensjahr vollendet. Nur bei Vorliegen besonderer Gründe kommt eine Verlängerung im Einzelfall in Betracht. Danach gilt der Student in der gesetzlichen Krankenkasse als freiwillig versicherter Student. Für freiwillig versicherte Studenten gibt es durch die BaföG-Änderung 2022 einen höheren Zuschlag für die Kranken- und Pflegeversicherung und zwar 168 EUR für die Krankenversicherung und 38 EUR für die Pflegeversicherung.
Quellen: BMG, BAFöG–Digital, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt