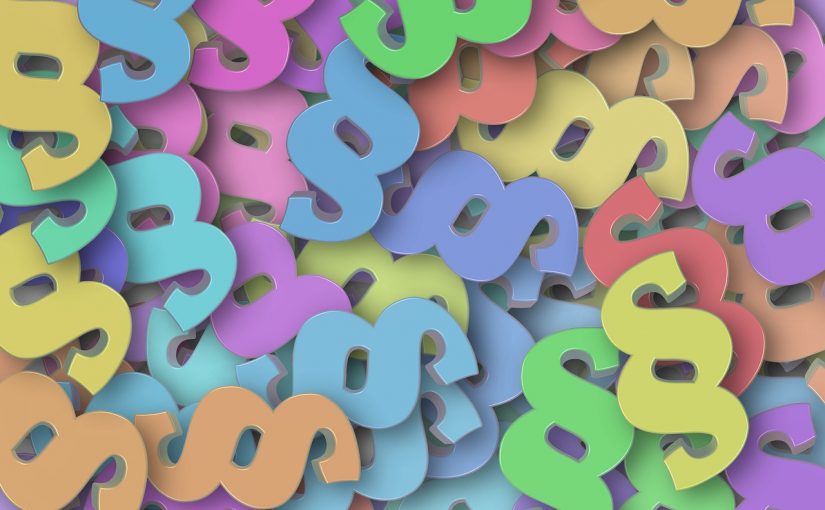Die mit dem BTHG eingeführte Personenzentrierung führt ab 2020 zur sog. Trennung der Leistungen im Vertragsrecht zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern.
Keine Trennung der Leistungen
Für minderjährigen Leistungsberechtigte und junge Volljährige, soweit Leistungen zur Teilhabe an Bildung in besonderen Ausbildungsstätten erbracht werden, erfolgt mit der Sonderregelung des § 134 ausnahmsweise keine Trennung zwischen Fachleistung und Lebensunterhalt. Demzufolge richtet sich das Vertragsrecht für den genannten Personenkreis nach wie vor nach den Regelungen des SGB XII, es bleibt also beim bisherigen System mit Grundpauschale, Maßnahmepauschale und Investitionsbetrag.
Der Grund ist wohl, dass eine umfassende Reform des SGB VIII angestrebt wird, in der alle Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Leistungssystem des SGB VIII zuammengeführt werden sollen. Dementsprechend ist in der Vereinbarung zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer nicht nur die Erbringung der Fachleistung, sondern auch die Erbringung der Hilfe zum Lebensunterhalt zu regeln.
Leistungs und Vergütungsvereinbarung
In der schriftlichen Vereinbarung zur Erbringung von Leistungen für minderjährige Leistungsberechtigte zwischen dem Träger der Eingliederungshilfe und dem Leistungserbringer sind zu regeln:
- Inhalt, Umfang und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der Leistungen (Leistungsvereinbarung) sowie
- die Vergütung der Leistung ( Vergütungsvereinbarung).
In die Leistungsvereinbarung sind als wesentliche Leistungsmerkmale insbesondere aufzunehmen:
1. die betriebsnotwendigen Anlagen des Leistungserbringers,
2. der zu betreuende Personenkreis,
3. Art, Ziel und Qualität der Leistung,
4. die Festlegung der personellen Ausstattung,
5. die Qualifikation des Personals sowie
6. die erforderliche sächliche Ausstattung.
Die Vergütungsvereinbarung besteht mindestens aus:
1. der Grundpauschale für Unterkunft und Verpflegung,
2. der Maßnahmepauschale sowie
3. einem Betrag für betriebsnotwendige Anlagen einschließlich ihrer Ausstattung (Investitionsbetrag).
Förderungen aus öffentlichen Mitteln sind anzurechnen. Die Maßnahmepauschale ist nach Gruppen für Leistungsberechtigte mit vergleichbarem Bedarf zu kalkulieren.
Volljährige in Internatsschulen
Die Sonderregelung für Kinder und Jugendliche ohne Trennung zwischen Fachleistung und Lebensunterhalt wird auf Volljährige ausgedehnt, die eine Internatsschule speziell für Menschen mit Behinderungen besuchen wie beispielsweise eine Internatsschule für blinde oder taubblinde Menschen.
Der Gesetzgeber hat damit die Notwendigkeit erkannt, dass es im Einzelfall sinnvoll und pädagogisch notwendig sein kann, über das 18. Lebensjahr hinaus in der Wohngruppe zu verbleiben, insbesondere um Brüche im Leistungsgeschehen zu vermeiden, die bei jungen Menschen gravierende Folgen haben können. Dem wird in Bezug auf das Leistungserbringungsrecht mit der Ausnahmeregelung des § 134 Abs. 4 SGB IX teilweise Rechnung getragen. Danach gilt die Sonderregelung des § 134 Abs. 1 bis 3 SGB IX auch über die Volljährigkeit hinaus, wenn Leistungsberechtigte eine Internatsschule speziell für Menschen mit Behinderung besuchen.
In allen übrigen Fällen, insbesondere also auch in den bisher und auch zukünftig stationären Wohneinrichtungen für minderjährige Leistungsberechtigte, sollte hingegen ab 01.01.2020 innerhalb einer Wohnform strikt zwischen minderjährigen und volljährigen Bewohnern unterschieden werden. Der Leistungserbringer, der in seiner Wohngruppe für Minderjährige die Trennung der Leistungen gem. § 134 SGB IX nicht vollzogen hat, müsste dies ab dem Tag der Volljährigkeit für diese einzelnen Leistungsberechtigten, die noch übergangsweise verbleiben, vollziehen. D. h. er müsste zwei völlig unterschiedliche Systeme der Vertragsgestaltung, Leistungserbringung und -abrechnung in einer Wohngruppe vorhalten und organisieren. Dieser Aufwand wäre für Leistungserbringer in der Regel nicht leistbar, zumal die Wohngruppen dem jungen Alter der Menschen angepasst in der Regel klein sind, bestehend oftmals aus 6-8 Bewohner/innen.
Volljährige in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Dieser Problematik soll zum 1.1.2020 mit Hilfe einer durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz eingebrachten Ergänzung des Absatz 4 entsprochen werden.
Danach müssen jedoch kumulativ folgende Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sein:
- Das Konzept des Leistungserbringers muss auf Minderjährige als zu betreuenden Personenkreis ausgerichtet sein. Bezieher der Leistungen des Leistungserbringers sind daher primär Minderjährige und nur vereinzelt Volljährige.
- Der Leistungsberechtigte hat von diesem Leistungserbringer vor Vollendung des 18. Lebensjahres bereits Leistungen über Tag und Nacht erhalten und erhält diese ohne zeitliche Unterbrechung mit dem Erreichen der Volljährigkeit weiter.
- Der volljährige Leistungsberechtigte bezieht die Leistungen für eine kurze Zeit und grundsätzlich nicht länger als bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres weiter.
Gründe dafür, dass ein Wechsel zu einem Leistungserbringer, dessen Konzept auf Volljährige als zu betreuenden Personenkreis ausgerichtet ist, unmittelbar mit Vollendung des 18. Lebensjahres nicht möglich ist, können sein:
- Die kontinuierlich von demselben Leistungserbringer erbrachten Leistungen dienen dazu, dass der Leistungsberechtigte Teilhabeziele, die er bereits als Minderjähriger anvisiert hat, zeitnah erreichen kann. Hierzu zählt insbesondere, dass eine bereits begonnene Schulausbildung mithilfe der Leistungen abgeschlossen werden soll.
- Neben Leistungen der Eingliederungshilfe werden auch weiterhin Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII benötigt, die durch den Verbleib bei dem Leistungserbringer weiterhin gemeinsam mit den Leistungen der Eingliederungshilfe aus einer Hand erbracht werden können.
- Der Umzug zu einem Leistungserbringer, dessen Konzept auf Erwachsene als zu betreuenden Personenkreis ausgerichtet ist, ist beabsichtigt, aber aus tatsächlichen Gründen unmittelbar mit Vollendung des 18. Lebensjahres nicht realisierbar (z.B. hat der ausgewählte und geeignete Leistungserbringer erst ein paar Monate nach Vollendung des 18. Lebensjahres Kapazitäten frei).
Kostenbeteiligung
Die ursprünglich geplante Kostenbeteiligung der Eltern volljähriger Kinder, die Internatsschulen speziell für Menschen mit Behinderungen besuchen wie beispielsweise eine Internatsschule für blinde oder taubblinde Kinder, wurde aufgrund des des Angehörigen-Entlastungsgesetzes gestrichen.
Für minderjährige Leistungsberechtigte werden bei einer Unterbringung beispielsweise in Internaten die Eltern zu einem Kostenbeitrag für die Verpflegung zur Kasse gebeten, soweit es ihnen zumutbar ist. Das soll einen Ausgleich darstellen für die zu Hause eingesparte Verpflegung.
Quelle: Bundestag, Thomas Knoche: Bundesteilhabegesetz Reformstufe 3: Neue Eingliederungshilfe, Walhalla-Verlag
Abbildung: pixabay.com geralt.png