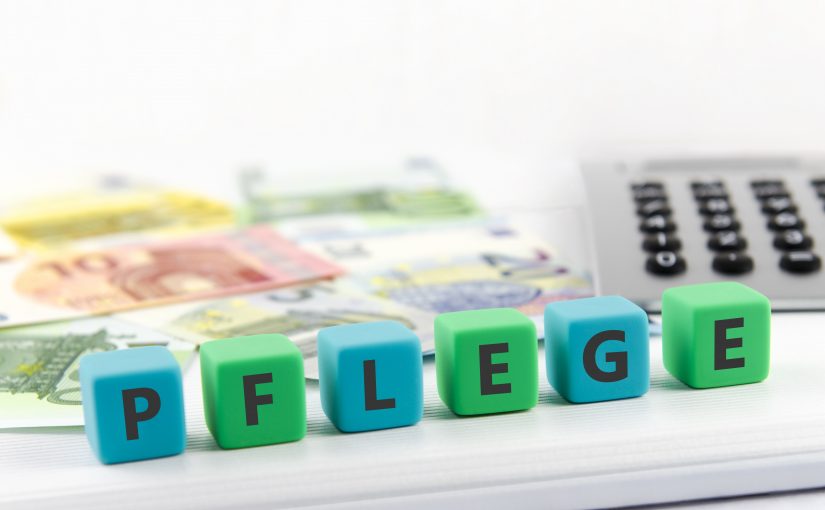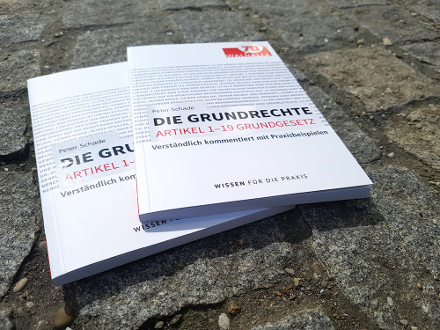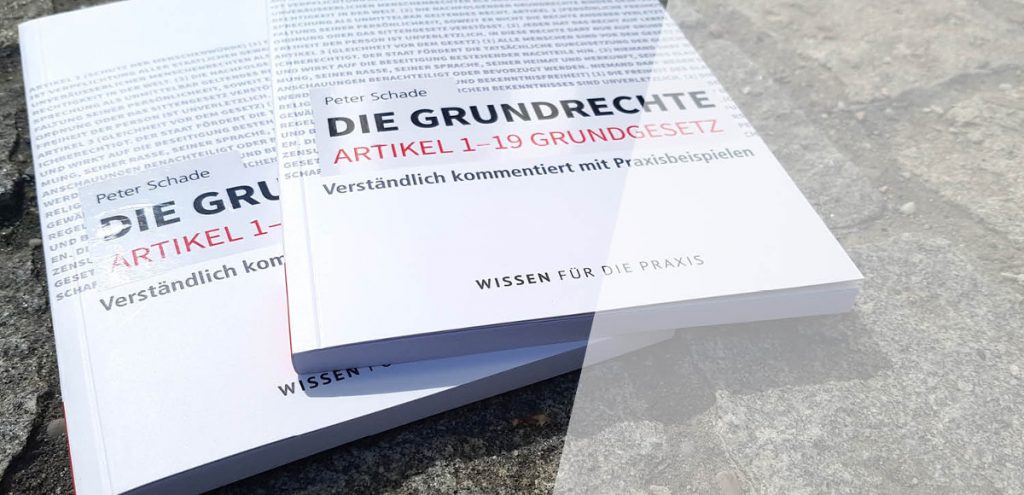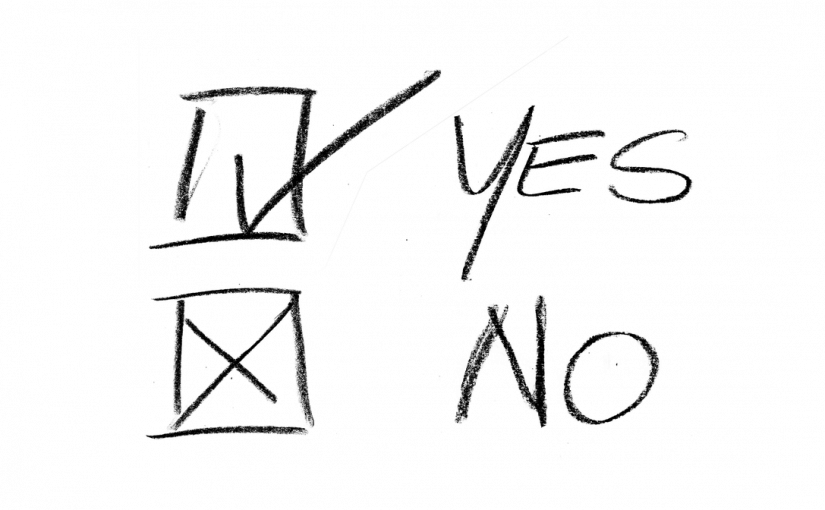Am Montag, 3.6.2019 kommt es im Innenausschuss zu einer Expertenanhörung zu dem von Innenminister geplanten „Geordnete Rückkehr Gesetz“. (Siehe auch den Beitrag vom 17.4.2019
Gesetzentwurf
Der vorliegende Referentenentwurf zielt darauf ab, die Zahl der ausreisepflichtigen Menschen, die Deutschland verlassen, zu steigern – und zwar insbesondere im Wege von Abschiebungen.
- Zu diesem Zweck werden gravierende Verschärfungen im Bereich der Abschiebungshaft vorgenommen, beispielsweise können Ausreisepflichtige jetzt auch in normalen Haftanstalten untergebracht werden.
- Eine neue Form der „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ wird geschaffen
- Sanktionen werden eingeführt für Personen, die bei der Passbeschaffung bzw. Identitätsklärung in vermeintlich nicht ausreichendem Maße mitwirken.
- Personen, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt wurden und ausreisepflichtig sind, sollen keine Leistungen nach dem AsylbLG mehr erhalten.
Offener Brief
Im Vorfeld veröffentlichte ein Bündnis von 22 zivilgesellschaftlichen Organisationen, darunter der Paritätische, die Diakonie, Amnesty International, Pro Asyl, AWO und das Deutsche Kinderhilfswerk, einen offenen Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Darin fordern sie die Abgeordneten auf, den Gesetzentwurf abzulehnen. Das Gesetz grenze sogar Familien und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dauerhaft von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus. Unverhältnismäßige Sanktionen würden eingeführt eine uferlose Ausweitung der Haftgründe. Die Unterzeichner fordern:
- Kein verfassungswidriger Ausschluss von Sozialleistungen
- Keine menschenunwürdigen Regelungen zur Abschiebungshaft
- Keine Einführung einer prekären „Duldung Light“
- Keine langen Vorduldungszeiten für Ausbildungs‐ und Beschäftigungsduldung
Ausführliche Erläuterungen zu den Forderungen hier.
Rüge der Menschenrechtskommissarin
Am 22. Mai äußerte sich die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, besorgt über das geplante Gesetz. Im Entwurf vorgesehen sein, dass Informationen über Abschiebungen künftig als «Staatsgeheimnisse»
eingestuft werden könnten, Nichtregierungs- und zivilen Organisationen könnte nach Einschätzung von Mijatovic eine rechtliche Verfolgung wegen Beihilfe drohen, sollten sie Details wie den Zeitpunkt der geplanten Rückführung
weitergeben. Die aktuelle Formulierung des Gesetzesentwurfs habe das
Potenzial, Tätigkeiten solcher Gruppierungen zu kriminalisieren.
Die Menschenrechtskommissarin rügte außerdem, dass durch das Gesetz
Migranten vor ihrer Rückführung leichter in Abschiebehaft genommen
werden könnten. Es gebe nur wenige Hinweise, dass erweiterte Möglichkeiten für Abschiebehaft zu mehr erfolgreichen Ausweisungen führten, erklärte Mijatovic. Sie bemängelte auch, dass Betroffene über Tag und Uhrzeit ihrer Abschiebung im Dunkeln gelassen werden sollen.
Quellen: Bundesinnenministerium, AMnesty INternational, EU-Info.Deutschland
Abbildung: pixabay.com: city-736807_1280.jpg