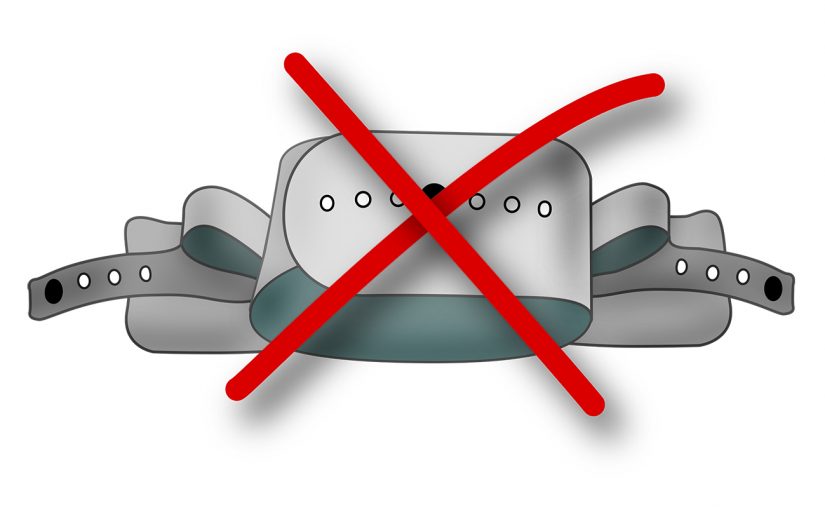Ein Heimbewohner bekam Unterstützung von der Sozialhilfe. Darin enthalten war auch der sogenannte Barbetrag. Die monatlich eingehenden Beträge hat das Heim für den Bewohner auf einem „Taschengeldkonto“ verwaltet. Das so angesparte Geld wollte ein Gläubiger des Bewohners pfänden. Das lehnten Amts- und Landgericht jedoch ab.
Der Bundesgerichtshof hingegen gab dem Gläubiger mit einer am 10. Juni 2020 veröffentlichten Entscheidung – jedenfalls teilweise – Recht (Beschluss vom 30. April 2020, Az. VII ZB 82/17). Dem Bewohner muss lediglich der monatliche Barbetrag verbleiben; bei einem Regelbedarf von aktuell 432 Euro sind das 116,64 Euro.
Zweckbindung ist zu beachten
Das Beschwerdegericht war noch der Auffassung, der Anspruch des Schuldners gegen den Drittschuldner auf „Auszahlungen vom Taschengeldkonto“ sei unpfändbar. Dies gelte unabhängig davon, ob Sozialhilfe im Sinne des § 27b Abs. 2 SGB XII (seit dem 1. Januar 2020: § 27b Abs. 3 SGB XII) oder ein entsprechender Betrag von der übergeleiteten Rente eines Selbstzahlers auf das vom Drittschuldner verwaltete „Taschengeldkonto“ gezahlt werde.
Dies sieht der BGH nicht uneingeschränkt so. Er differenziert und argumentiert mit der Zweckbindung. Nach § 851 Abs. 1 ZPO ist eine Forderung der Pfändung nur insoweit unterworfen als sie übertragbar ist. Damit verweist § 851 Abs. 1 ZPO unter anderem auf die Regelung des § 399 1. Fall BGB. Danach kann eine Forderung nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann. § 399 1. Fall BGB erfasst Forderungen, die aufgrund ihres Leistungsinhalts eine so enge Verknüpfung zwischen den Parteien des Schuldverhältnisses herbeiführen, dass mit einem Wechsel in der Gläubigerposition ein schutzwürdiges Interesse des Schuldners verletzt würde oder die Identität der Forderung nicht gewahrt bliebe, etwa weil die Leistungshandlung im Hinblick auf den Empfänger einen besonderen Charakter annimmt. Hierzu gehören zweckgebundene Forderungen, soweit der Zweckbindung ein schutzwürdiges Interesse zugrunde liegt.
Barbetrag unpfändbar
Eine solche rechtlich beachtliche Zweckbindung ist gegeben, soweit die vom Heimträger auf dem „Taschengeldkonto“ verwalteten Geldbeträge der Höhe nach dem angemessenen Barbetrag gemäß § 27b Abs. 3 SGB XII entsprechen. Aus der genannten Vorschrift ergibt sich, dass der notwendige Lebensunterhalt des Bewohners einer Pflegeeinrichtung neben den in dieser Einrichtung gewährten Leistungen auch einen angemessenen Barbetrag für seine darüber hinausgehenden persönlichen Bedürfnisse umfasst. Der vom Gesetzgeber in § 27b Abs. 3 SGB XII festgelegte angemessene Barbetrag zur persönlichen Verfügung dient damit der Sicherung eines menschenwürdigen Daseins. Da es den Bewohnern einer Pflegeeinrichtung nicht in allen Fällen möglich ist, sich in ausreichendem Maße persönlich um die Verwaltung der Barbeträge zu kümmern, kann diese Aufgabe von dem Heimträger übernommen werden. Die Verwaltung erfolgt in diesem Fall treuhänderisch für die betreffenden Bewohner der Pflegeeinrichtung. Der Heimträger darf Auszahlungen von dem „Taschengeldkonto“ nur zugunsten des betreffenden Bewohners oder zur Begleichung von Forderungen, die zur Deckung dessen persönlichen Bedarfs entstanden sind, vornehmen. Als Beitrag zum notwendigen Lebensunterhalt des Bewohners einer Pflegeeinrichtung ist dessen Auszahlungsanspruch gegen den Heimträger in dem sich aus § 27b Abs. 3 SGB XII ergebenden Umfang zweckgebunden. Dies gilt unabhängig davon, ob der auf dem „Taschengeldkonto“ verwaltete Geldbetrag aus Mitteln der Sozialhilfe oder aus einer Rente stammt.
Aufgrund dieser Zweckbindung scheidet eine Abtretung in dem genannten Umfang und damit auch eine Pfändung des Auszahlungsanspruchs aus. Gegenüber der Zweckbindung des der Deckung des notwendigen Lebensunterhalts und der Sicherung eines menschenwürdigen Daseins dienenden Auszahlungsanspruchs des Schuldners gegen den Drittschuldner hat die durch Art. 14 GG geschützte Rechtsposition der Gläubigerin zurückzutreten.
Übersteigende Beträge sind pfändbar
Dagegen ist eine zur Unpfändbarkeit führende Zweckbindung insoweit zu verneinen, als die vom Drittschuldner auf dem „Taschengeldkonto“ verwalteten Geldbeträge der Höhe nach den angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung gemäß § 27b Abs. 3 SGB XII (bis 31.12.2019: § 27b Abs. 2 SGB XII) übersteigen. Denn insoweit dient der Auszahlungsanspruch des Schuldners gegen den Drittschuldner nicht mehr der Deckung seines notwendigen Lebensunterhalts und ein besonderes, schutzwürdiges Interesse des Drittschuldners an der Beibehaltung seines Gläubigers ist nicht ersichtlich. Allein die Vereinbarung einer Verwaltung von Geld auf einem „Taschengeldkonto“ – ohne Bezug zum notwendigen Lebensunterhalt des Bewohners einer Pflegeeinrichtung – kann daher eine Zweckbindung und damit eine Unpfändbarkeit des betreffenden Auszahlungsanspruchs gemäß § 851 Abs. 1 ZPO, § 399 1. Fall BGB nicht begründen. Anderenfalls hätte es ein Schuldner, der sich in einer Pflegeeinrichtung befindet, in der Hand, auf diese Weise die Teile seines Vermögens dem Zugriff seiner Gläubiger zu entziehen, derer er zur Deckung seines notwendigen Lebensunterhalts nicht bedarf.
Leitsatz des Gerichts
„Der Anspruch des sich in einer Pflegeeinrichtung befindlichen Schuldners gegen den Träger der Pflegeeinrichtung auf Auszahlung des gegenwärtig auf einem „Taschengeldkonto“ verwalteten Guthabens sowie die künftigen Ansprüche des Schuldners gegen den Träger der Pflegeeinrichtung auf Auszahlung der jeweils monatlich auf dem „Taschengeldkonto“ eingehenden Geldbeträge sind gemäß § 851 Abs. 1 ZPO, § 399 1. Fall BGB jeweils bis zu der Höhe unpfändbar, die in § 27b Abs. 3 SGB XII für den angemessenen Barbetrag geregelt ist. Diese Vorschriften stehen einer Pfändbarkeit indes grundsätzlich nicht entgegen, soweit das jeweils vorhandene Guthaben den sich aus § 27b Abs. 3 SGB XII für einen Monat anzusetzenden Betrag übersteigt.“
Zur BGH-Entscheidung: www.rechtsprechung-im-internet.de