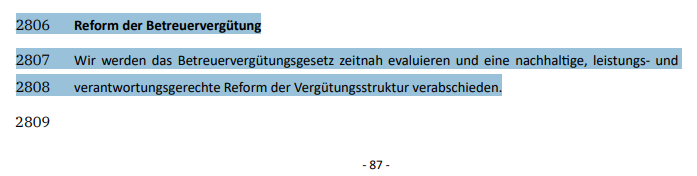Die Justizministerkonferenz (JuMiKo) hat sich auf seiner Tagung vom 4. bis 6. Juni 2025 klar für den Abbau unnötiger bürokratischer Hürden im Betreuungsrecht ausgesprochen, um eine qualitativ hochwertige Betreuung auch künftig nachhaltig zu sichern. Die Länder betonen, dass die hohe Qualität der rechtlichen Betreuung – angesichts des demografischen Wandels und des wachsenden Bedarfs – nur erhalten werden kann, wenn sowohl ehrenamtliche als auch berufliche Betreuer von übermäßigen bürokratischen Belastungen entlastet werden.
Konkret fordern die Justizministerinnen und Justizminister
- Eine Überprüfung und Reduzierung der Berichts-, Genehmigungs- und Rechnungslegungspflichten für Betreuer auf das unbedingt notwendige Maß, das zum Schutz der Betreuten erforderlich ist. Dies betrifft insbesondere:
- die Vorgaben für Jahresberichte,
- die Rechnungslegungspflichten, auch wenn keine Vermögensgefährdung vorliegt,
- Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz wird gebeten, diese Pflichten auf mögliche Vereinfachungen hin kritisch zu überprüfen, um die Betreuungspraxis zu entlasten und die Qualität der Betreuung zu sichern.
Erleichterung der Registrierung beruflicher Betreuer
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Erleichterung der Registrierung als beruflicher Betreuer. Bislang ist eine Registrierung nur für Selbstständige oder Mitarbeiter von Betreuungsvereinen möglich. Künftig soll auch Angestellten eines beruflichen Betreuers die Registrierung ermöglicht werden, um die Nachwuchsgewinnung zu erleichtern und eine bessere Einarbeitung sowie Übergabe bei altersbedingten Rückzügen zu gewährleisten.
Hintergrund und Zielsetzung
Die Länder reagieren damit auf den zunehmenden Nachwuchsmangel im Bereich der rechtlichen Betreuung und den steigenden Bedarf durch den demografischen Wandel. Ziel ist es, das Ehrenamt und den Beruf des Betreuers attraktiver zu machen und unnötige bürokratische Hürden abzubauen, ohne den Schutz der betreuten Menschen zu gefährden.
Den Beschluss im Wortlaut kann man hier nachlesen: https://www.justiz.sachsen.de/smj/download/Beschluesse96JuMiKoFruehjahr.pdf