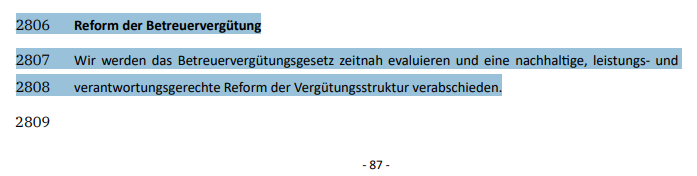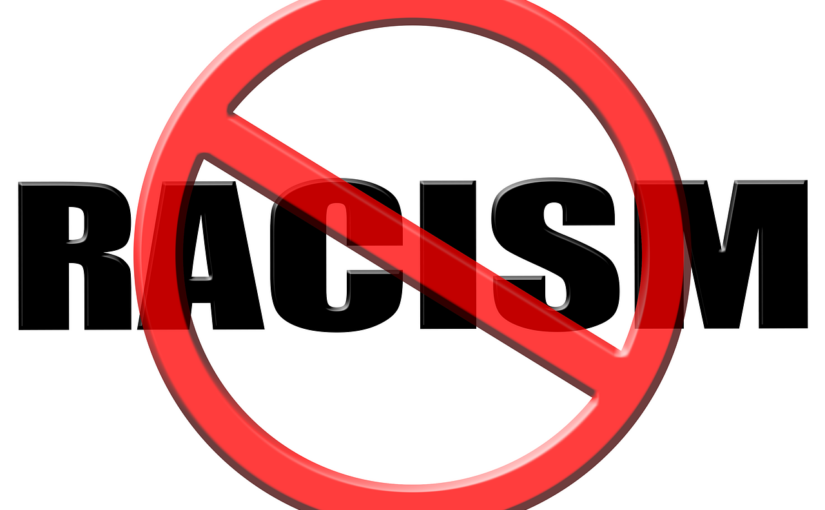Zum Versicherungsfall in der Unfallversicherung zählt die Berufskrankheit. (§ 9 SGB VII). Welche Erkrankungen zu den Berufskrankheiten zählen, ist im Regelfall durch Rechtsverordnung der Bundesregierung festgelegt. Darüber hinaus steht den Berufsgenossenschaften eine Einzelfallentscheidung über neu auftretende – von der Rechtsverordnung noch nicht erfasste – Berufskrankheiten zu.
Anerkennungsfähige Berufskrankheiten
Ursache dafür können verschiedenste gesundheitsschädliche Einwirkungen sein. Insbesondere kommen bestimmte Chemikalien, physikalische Einwirkungen wie Druck, Vibrationen oder das Tragen schwerer Lasten und Arbeiten unter Lärm oder Staub in Betracht. Nicht jede Erkrankung kann aber als Berufskrankheit anerkannt werden. Als Berufskrankheit kommen nur solche Erkrankungen in Frage, die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht werden. Diesen Einwirkungen müssen bestimmte Personengruppen durch ihre Arbeit in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sein. Die derzeit anerkennungsfähigen Berufskrankheiten sind in der Anlage 1 zur BKV zu finden.
BKV-Änderungsverordnung
Die Bunderegierung hat eine Ergänzung der Berufskrankheiten-Verordnung um drei weitere Berufskrankheiten beschlossen, der der Bundesrat Mitte Februar zugestimmt hat. Die Verordnung trat am 1. April 2025 in Kraft.
Dabei handelt es sich um folgende Erkrankungen:
- Schädigung der Rotatorenmanschette der Schulter durch eine langjährige und intensive Belastung;
- chronische obstruktive Bronchitis einschließlich Emphysem durch langjährige Einwirkung von Quarzstaub;
- Gonarthrose bei professionellen Fußballspielerinnen und Fußballspielern.
„Wie-Berufskrankheiten“
Mit der Erweiterung der Liste der Berufskrankheiten wird Rechtssicherheit über die jeweiligen Anerkennungsvoraussetzungen der Erkrankungen geschaffen. Die neuen Berufskrankheiten folgen den Empfehlungen des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten (ÄSVB) beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Um den Zeitraum zwischen der jeweiligen wissenschaftlichen Empfehlung des ÄSVB und dem Inkrafttreten der Ergänzung der Berufskrankheiten-Verordnung zu überbrücken, konnten die Erkrankungen bislang als sogenannte „Wie-Berufskrankheiten“ nach § 9 Abs. 2 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch anerkannt werden.
Betroffenen stehen sowohl bei „Wie-Berufskrankheiten“ als auch bei Berufskrankheiten, die in die Berufskrankheiten-Verordnung aufgenommen wurden, die gleichen Leistungen zu. Dabei handelt es sich z.B. um den Anspruch auf Heilbehandlung und Rehabilitation durch die gesetzliche Unfallversicherung. Bei Arbeitsunfähigkeit oder dauerhafter Erwerbsminderung können auch Ansprüche auf Geldleistungen bestehen.
Meldung an den zuständigen Unfallversicherungsträger
Ärztinnen und Ärzte haben bei Verdacht auf eine der jeweiligen Krankheiten eine Meldung an den zuständigen Unfallversicherungsträger zu erstatten. Auch die Betroffenen können sich jederzeit dort melden.
Die Aufnahme der Erkrankung „Parkinson-Syndrom durch Pestizide“ in die Berufskrankheiten-Verordnung ist aktuell noch nicht möglich, weil der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten hierzu noch Rückfragen klärt. Da auch diese Erkrankung bereits als sogenannte „Wie-Berufskrankheit“ anerkannt werden kann, führt dies nicht zu Nachteilen für die Betroffenen.
Abbildung: pixabay.com man-597178_1280.jpg