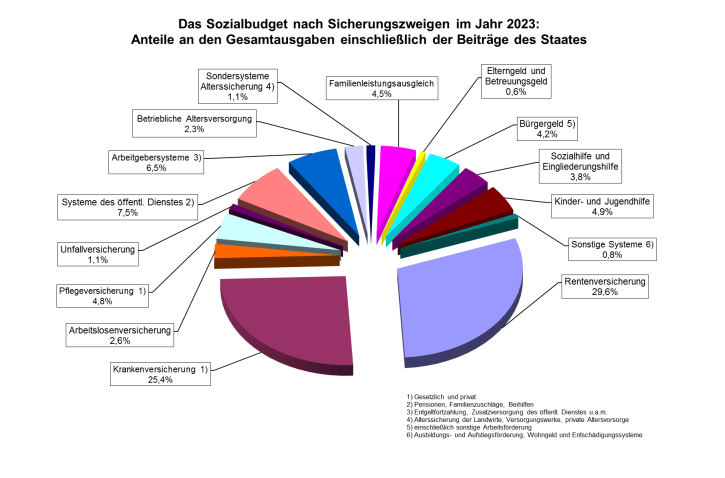Die Kommission zur Sozialstaatsreform hat Vorschläge für einen modernen Sozialstaat erarbeitet. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Leitung dieser Regierungskommission inne und setzt damit einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag um. Der KSR gehören Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände an. Am 27. Januar wurde der Bericht vom BMAS online gestellt.
Reformkonzept
Der Bericht stellt ein umfassendes Reformkonzept für die steuerfinanzierten Sozialleistungen mit dem dreifachen Ziel dar, spürbare Erleichterungen für Bürger*innen zu erzielen, den Verwaltungsvollzug deutlich zu vereinfachen und einen digitalen Neustart des Sozialstaats auf den Weg zu bringen. Die Empfehlungen der Kommission sollen zudem positive Arbeitsmarkt- und Fiskaleffekte bewirken.
Die Umsetzung der Empfehlungen soll zeitnah beginnen. Die Kommission hat in ihrem Bericht auch Perspektiven zur Umsetzung vorgelegt.
Empfehlungen der Komission in Schlagworten:
Der Sozialstaat muss einfacher und verständlicher werden, durch:
- Zusammenlegung von Leistungen
- Beantragung der Sozialleistungen über ein einheitliches, digitales Portal
- wohnortnahe Beratungsangebote
Der Sozialstaat muss unbürokratischer und effizienter werden durch:
- weniger Schnittstellen und verkürzte Bearbeitungszeiten
- antragslose Auszahlung des Kindergelds
- einheitlichere Rechtsbegriffe und stärkere Pauschalierungen
Der Sozialstaat muss digitaler werden durch:
- erleichterten Datenaustausch zwischen Sozialbehörden
- einheitliche IT-Standards
- digitaltauglichen Sozialdatenschutz, bei hohem Schutzniveau
- stärker automatisierte Prozesse (auch unter Nutzung von KI)
Diskussionen folgen
Wie die Umsetzung der Empfehlungen tatsächlich gelingt, welche Kritikpunkte und Änderungsideen, etwa von Sozial- und Wirtschaftsverbänden noch kommen und welche tatsächlichen finanziellen Auswirkungen auf Einzelne und auf die Gesamtgesellschaft zukommen, wird in den nächsten Monaten auch hier auf FOKUS-Sozialrecht noch das eine oder andere Mal Thema sein.
Quelle: BMAS
Abbildung: AdobeStock_312736139-scaled.jpg