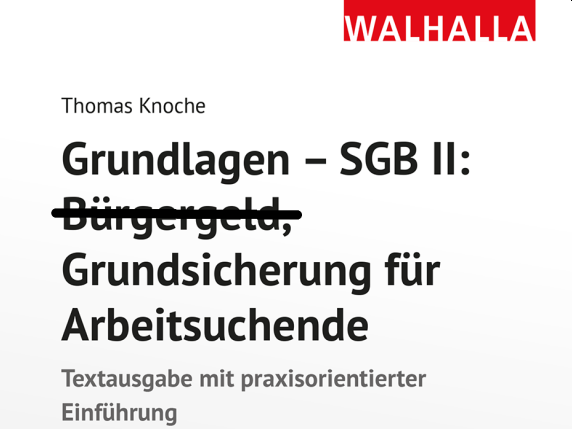Laut Pressemitteilung des BMAS hat das Bundeskabinett am 17.12.2025 den Gesetzentwurf zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beschlossen. Die Bundesregierung setzt mit dem 13. SGB II-Änderungsgesetz den entsprechenden Auftrag aus dem Koalitionsvertrag um. Mit dem Gesetz soll das Verhältnis zwischen Solidarität und Eigenverantwortung im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch neu ausbalanciert werden. Dabei komme es sowohl auf die Mitwirkung der leistungsbeziehenden Menschen an, als auch darauf, den Jobcentern wirksamere Instrumente an die Hand zu geben, mit denen diese eingefordert werden kann. Zugleich sollten die Jobcenter Langzeitarbeitslose noch besser auf dem Weg in Arbeit unterstützen können. Jobcenter erhiellten darüber hinaus wirksamere Instrumente zur Bekämpfung des Sozialleistungsmissbrauchs.
Kernpunkte
Das BMAS fasst die wesentlichen Änderungen wie folgt zusammen:
- Umbenennung der Geldleistung „Bürgergeld“ in „Grundsicherungsgeld“
- Einfordern bedarfsdeckender Integration (Vollzeit)
- Stärkung der Vermittlung und des Vermittlungsvorrangs
- Frühzeitigere Integration von Erziehenden in den Arbeitsmarkt
- Verbindliche Einladung zu einem persönlichen Erstgespräch
- Höhere Verbindlichkeit beim Kooperationsplan
- Verbesserung bei der Eingliederung Langzeitleistungsbeziehender (§ 16e SGB II)
- Konsequentere Leistungsminderungen bei Pflichtverletzungen
- Wirksames, gestuftes Verfahren bei Terminverweigerung – mit Möglichkeit, die Leistung vollständig einzustellen
- Wirkungsvollere und praxistauglichere Ausgestaltung der Regelung bei Arbeitsverweigerung
- Abschaffung der Karenzzeit beim Vermögen, Kopplung der Höhe des Schonvermögens an das Lebensalter
- Deckelung der Wohnkosten schon in der Karenzzeit
- Berücksichtigung einer örtlich festgelegten Mietpreisbremse
- Möglichkeit, eine Quadratmeterhöchstmiete festzulegen
- Regelungen zur Bekämpfung von Sozialleistungsmissbrauch
- Gesetzliche Verankerung und Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers zur Stärkung des Prinzips „Arbeit statt Leistungsbezug“
- Verbesserung der Beratung und Unterstützung von Jugendlichen in der Arbeitsförderung des SGB III
- Digitalisierung und Automatisierung von Verwaltungsabläufen sowie Pilotierung neuer Technologien
Zeitplan
Das Gesetz soll im ersten Quartal 2026 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Die Regelungen sollen größtenteils voraussichtlich zum 1. Juli 2026 in Kraft treten. Weitere Informationen veröffentlicht das BMAS auf seiner „Fragen und Antworten“ – Seite.
Kritik
Massive Kritik gibt es von verschiedenen Sozialverbänden bis hin zu Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der verschärften Sanktionsregelungen
Quellen: BMAS, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: Buergergeld-Ende-1.png (Walhalla, T.Knoche)