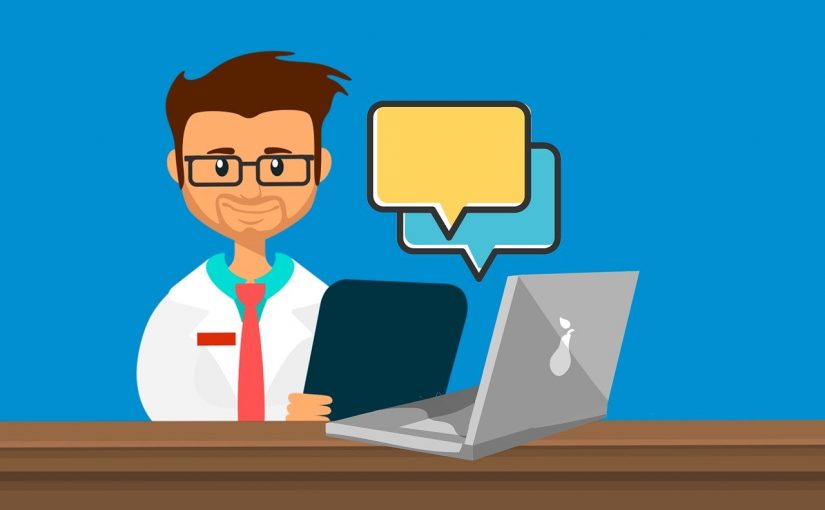Der jüngste Bericht des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) über die Inanspruchnahme und Entwicklung der Versorgung mit Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) 2024 liegt als Unterrichtung (21/110) der Bundesregierung vor. Zum vierten Mal berichtet der Verband über die Versorgung mit DiGAs, die seit September 2020 flächendeckend als Leistung der GKV zur Verfügung stehen.
Seit vier Jahren im GKV-Leistungskatalog
Nach vier Jahren falle die Bilanz ernüchternd aus. Das Verfahren zur Implementierung der DiGA in den GKV-Leistungskatalog habe sich aus Sicht der Beitragszahler nicht bewährt, heißt es im Vorwort des Berichts.
Zwar bestehe durch DiGAs ein großes Potenzial für eine verbesserte gesundheitliche Versorgung, jedoch könne im Rahmen des Bewertungsverfahrens der Nutzen der meisten DiGAs zunächst nicht belegt werden. Die Erprobungs- und Preismechanismen führten in vielen Fällen zu unnötigen Mehrkosten. Dies könne in Zeiten einer historisch defizitären Finanzsituation der GKV kein gangbarer Weg sein.
Wenige DiGas sind nützlich
Von den 68 DiGAs, die bis Ende 2024 in das Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aufgenommen wurden, hätten lediglich zwölf ihren Nutzen von Beginn an nachweisen können, heißt es in dem Bericht weiter.
Zudem stünden Preise und Nutzen in keinem angemessenen Verhältnis. Die meisten Hersteller stellten einen Antrag auf vorläufige Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis für eine zunächst einjährige Erprobung. Im ersten Jahr der Aufnahme in das Verzeichnis könnten die Hersteller den Preis selbst bestimmen. Der höchste Herstellerpreis habe bislang bei 2.077 Euro gelegen, der durchschnittliche Herstellerpreis bei 541 Euro. Der durchschnittliche Herstellerpreis für 2024 lag demnach bei 585 Euro.
Solidargemeinschaft belastet
Bei Aussichten auf eine erfolgreiche DiGA-Nutzenbewertung bestehe die Möglichkeit, die Erprobung auf ein zweites Jahr zu verlängern. Bei einem erfolgreichem Verfahren gelte der verhandelte Preis rückwirkend ab dem zweiten Jahr. Dies führe bei Insolvenzen der Hersteller zu offenen Forderungen der GKV, die sich bislang auf annähernd 20 Millionen Euro summiert hätten.
Die derzeit gültigen Regelungen bereiteten den Herstellern das Geschenk eines hohen Preises zulasten der Solidargemeinschaft, obwohl der Nutzen gering, wenn überhaupt gegeben sei. Der Verband forderte den Gesetzgeber auf, diesen Missstand zu beseitigen.
234 Millionen Euro
Bis 31. Dezember 2024 wurden dem Bericht zufolge insgesamt mehr als eine Million DiGAs ärztlich verordnet oder von den Krankenkassen genehmigt, die Leistungsausgaben der GKV für DiGA lagen bei 234 Millionen Euro. Am häufigsten werden DiGAs zur Behandlung von psychischen Erkrankungen in Anspruch genommen (30 Prozent), bei Stoffwechselkrankheiten (28 Prozent) und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems (16 Prozent).
Quellen: Bundestag, Gkv-Spitzenverband, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: AdobeStock_302010676.jpg