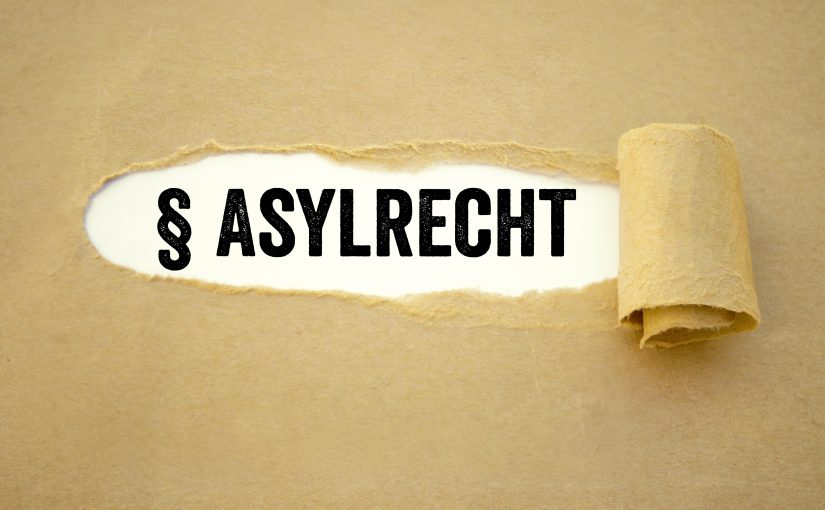Über das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung, dass am 16.08.2019 in Kraft getreten ist berichteten wir hier.
Am Beispiel des darin geänderten § 129 SGB V berichtet Abgeordnetenwatch nun, welchen Einfluss Lobbyisten auf die Gesetzgebung haben. Aber der Reihe nach.
Gesetzesinitiative Brandenburgs
Nach einigen Arzneimittelskandalen will Gesundheitsminister Jens Spahn dem nun entgegensteuern. Unter anderem geht es um die Importquote bei Arzneimitteln, festgelegt in eben jenem § 129 SGB V. Es gab auch schon eine Initiative des Landes Brandenburg deswegen: an dem Importmodell seien regelmäßig diverse Händler, Umverpacker und Importeure in verschiedenen Staaten beteiligt. Ursprung und Handelsweg der Medikamente seien kaum nachvollziehbar. Das Aufklären von Fällen gefälschter Präparaten gestalte sich deshalb als extrem schwierig.
Gesetzentwurf von Jens Spahn
Das Gesundheitsministerium schlägt in seinem Gesetzentwurf im November 2018 den Kompromiss vor:
§ 129 wird wie folgt geändert: In Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „oder mindestens 15 Euro“ gestrichen.
Die Vorgabe eines Preisabstands von 15 Euro, ab der nach Maßgabe des Rahmenvertrags ein preisgünstiges importiertes Arzneimittel abzugeben ist, hat sich überholt und wird gestrichen. Der generelle Preisabstand von 15 % solle aber bleiben.
Bedenken des Wirtschaftsministeriums
Das Wirtschaftsministerium äußert prompt Bedenken und schreibt am 21.11.2018: „Es gibt zahlreiche Unternehmen, die sich auf den Arzneimittelimport spezialisiert haben (z.B. Kohlpharma, MPA Pharma, EMRAmed). Sie profitieren direkt von der Importförderklausel, insbesondere von der Zunahme hochpreisiger Arzneimittel in der Versorgung. Aufgrund der 15,-Euro-Regelung steigt die Handelsmarge der Importeure je höher der Preis des Arzneimittels in Deutschland ist. Die Importeure können den überwiegenden Teil des Preisunterschiedes abschöpfen.“ Das BMWi stimmt nach einigem Hin- und Her, angesichts der Tatsache, dass Verbände, Patientenvertretungen und Kassen einheitlich für die komplette Streichung der Klausel seien, dem Spahn-Vorschlag zu, vorausgesetzt, der Chef, Herr Altmaier, habe keine Bedenken.
Die Lobby greift ein
Anfang Januar 2019 erhält das Wirtschaftsministerium eine Mail eines Mitarbeiters der Firma Kohlpharma. Kohlpharma macht Geschäfte mit Arzneimittelimporten und profitiert hervorragend von der bestehenden Importklausel. Der Sitz der Firma ist in Merzig im Wahlkreis von Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Inhalt der Mail:
„… Diese Neuregelung würde den Import gerade höherpreisiger Arzneimittel nahezu unmöglich machen, da diese Preisabstände zwischen den europäischen Märkten nur in Ausnahmefällen existieren. Gerne würde ich darüber kurz mit Ihnen telefonieren.“ Der Kohlpharma-Lobbyist hat auch gleich einen Vorschlag parat, wie der Gesetzestext besser lauten solle:
„§ 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB V könnte wie folgt lauten : 2. ,,Abgabe von preisgünstigen importierten Arzneimitteln, deren für den Versicherten maßgeblicher Arzneimittelabgabepreis unter Berlicksichtigung der Abschläge nach § 130a Absatz 1, la, 2, 3a und 3b mindestens 15 vom Hundert bei einem Abgabepreis bis einschließlich 100,00 EUR oder mindestens 15,00 EUR bei einem Abgabepreis von über 100,00 EUR bis einschließlich 300,00 EUR oder von mindestens 5 % bei einem Abgabepreis von über 300,00 EUR niedriger ist als der Preis des Bezugsarzneimittels; …. „
Telefonate
Tatsächlich fanden dann Mitte Januar 2019 „Telefonate“ Zwischen Herrn Altmaier und Jörg Geller, Vorstand Kohl Medical AG statt, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion (Drucksache 19/9167 vom 5.4.2019) hervorgeht.
Inzwischen, also Mitte Januar 2019, legt Minister Spahn dei Kabinettvorlage zu seinem Gestz vor. Die enthält nun eine völlige Streichung der Importklausel.
Altmaier vs Spahn
In den Tagen darauf kommt es wohl zu heftigen Interventionen des Wirtschaftsministers bei seinem Kabinettskollegen. Das Ergebnis wird am 21.1.2018 mitgeteilt: „..haben sich BM Altmaier und BM Spahn nach hiesiger Kenntnis zur Importregelung verständigt. Diese soll dem zwischen DAV und GKV-SV neu gefassten Rahmenvertrag zur Arzneimittelversorgung entsprechen: 15 Prozent bis 100 Euro, 15 Euro bis 300 Euro und ab dann 5 Prozent.“
Genauso sieht dann die neue Fassung der Kabinettsvorlage vom 25.1.2018 aus und wird ein paar Tage später im Kabinett verabschiedet.
Bundesrat lehnt ab
Nun muss das Gesetz aber noch in den Bundesrat. Der lehnt ab: „Die derzeit geltende Importquote verpflichtet deutsche Apotheker, günstigere Medikamente aus dem Auslandsvertrieb zu nutzen, um die Krankenkassen zu entlasten. Der Bundesrat kritisiert diese Quote als bürokratische Doppelregulierung ohne großes Einsparpotenzial. Durch neuere preisregulierende Gesetze und aktuelle Rabattvereinbarungen habe sie erheblich an Bedeutung verloren. Der Importzwang berge zudem die Gefahr nicht mehr nachvollziehbarer Handelswege.“
Einwände werden geprüft und – abgelehnt
Die Bundesregierung lehnt den Einwand des Bundesrates nicht direkt ab, sondern verspricht, die Einwände zu prüfen. Das WIrtschaftsministerium freut sich: „Das BMG geht also offensichtlich auch davon aus, dass das Plenum des Bundesrates der Beschlussempfehlung des federführenden Gesundheitsausschμsses folgen wird, daher soll die „weiche“ Formulierung „Prüfung“ verwendet werden und nicht die „harte“ · Formulierung „Ablehnung“. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist mit dieser Formulierung nicht gefährdet.“
So ist es. Das Gesetz wird mit der vom Lobbyisten vorgegeben Formulierung des § 129 SGB V verabschiedet und gilt seit dem 16.8.2019.
Quellen: Abgeordnetenwatch.de Bundestags- und Bundesrats-Drucksachen
Abbildung: AdobeStock_45632710.jpeg