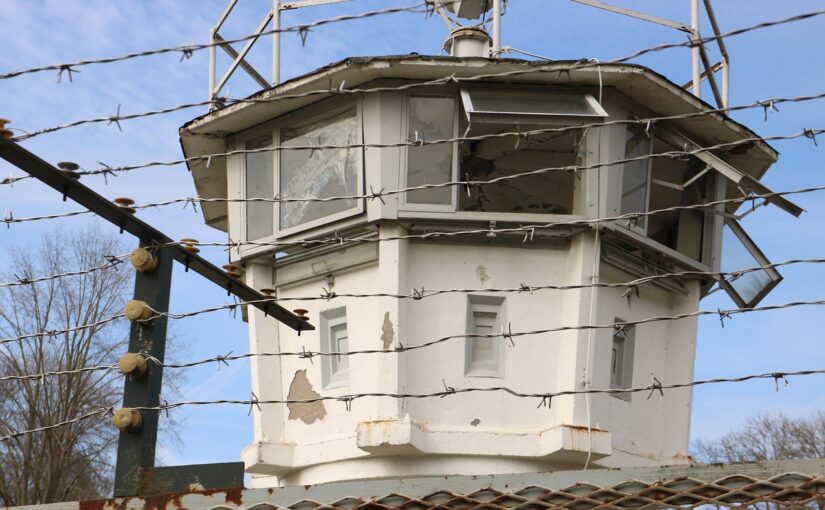Eine Anerkennung als Opfer nationalsozialistischer Gewalt bedeutet für betroffene Menschen oder für Gruppen von Menschen eine kleine Entschädigung für erlittenes Unrecht und Leid. Seit dem 1. Januar 2021 regelt das Soziale Entschädigungsrecht (SGB XIV) die Leistungen für Opfer von Gewalt- und Unrechtsmaßnahmen, einschließlich der Opfer des Nationalsozialismus. Das SGB XIV hat das bisherige Bundesentschädigungsgesetz (BEG) und andere Regelungen abgelöst und zusammengeführt, wobei das BEG weiter Gültigkeit hat für die Opfer der Gewaltherrschaft zwischen 1933 und 1945. Das bedeutet Anspruch auf Heil- und Krankenbehandlung, Renten und laufende Geldleistungen, Entschädigungszahlungen und Soziale Hilfen. Ebenso wichtig ist eine offizielle Anerkennung als NS-Opfer für die persönliche und familiäre Aufarbeitung, aber auch durch Forschung oder in Gedenkeinrichtungen.
Kampf um Anerkennung
Auch mehr als 70 Jahre nach Ende der Schreckensherrschaft müssen gesellschaftliche Gruppen immer noch um ihre Anerkennung als NS-Opfer kämpfen. Erst Anfang letzten Jahres hat der deutsche Bundestag behinderte und psychisch kranke Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet und misshandelt wurden, ausdrücklich als Opfer des NS-Regimes anerkannt. Eine endgültige rechtliche Festschreibung steht aber noch aus.
Sinti und Roma dagegen müssen immer noch um die Anerkennung kämpfen, genau wie queere Menschen. „Queer“ wird hier als Sammelbegriff für schwule Männer, Bisexuelle, Crossdresser:innen, transgeschlechtliche Menschen und lesbische Frauen sowie intergeschlechtliche Menschen verwendet. Für sie gab es bisher keine Entschädigungen für die Verfolgung, Inhaftierung oder Unterbringung in einem Konzentrationslager bzw. als Opfer von Sterilisation, Kastration, „freiwillige Entmannung“ und Menschenversuche.
Antrag für die vergessenen Opfer
Am 28. Januar berät nun der Bundestag einen Antrag der Fraktion Die Linke (21/3659) mit dem Titel „Die ,vergessenen‘ queeren Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung“. Nach 30-minütiger Debatte soll die Vorlage dem federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur weiteren Beratung überwiesen werden.
Im Antrag wird der Bundestag aufgefordert, anzuerkennen, „dass den queeren Opfern aufgrund der jahrzehntelangen Verweigerung der Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus großes Unrecht angetan wurde“. Für das damit verbundene Leid soll der Bundestag nach Auffassung der Fraktion die Opfer und ihre Hinterbliebenen um Verzeihung bitten. Von der Bundesregierung fordert die Fraktion unter anderem, dafür Sorge zu tragen, dass die queeren Opfer des Nationalsozialismus „dauerhaft im kollektiven Gedächtnis sichtbar werden“. Ferner solle die Bundesregierung den Wiederaufbau eines Instituts für Sexualwissenschaften zum 100. Jahrestag der Verwüstung durch die Nationalsozialisten im Jahr 2033 unterstützen.
Keine finanziellen Entschädigungen
Die queeren Opfer der NS-Zeit wurden nach unterschiedlichen Kriterien und auf
unterschiedliche Weise verfolgt. Die größte und am meisten verfolgte Gruppe waren schwule und bisexuelle Männer. Sie wurden von den Nationalsozialisten nach
der Kategorie „Homosexuell“ verfolgt. Strafrechtlich war hier der § 175 StGB
(insbesondere durch die Verschärfung ab 1935) von großer Relevanz. Auch
Crossdresser*innen bzw. trans Personen waren Verfolgung ausgesetzt. Lesbische und bisexuelle Frauen konnten auch anhand der Kategorie „Asozial“ verfolgt werden.
Beide deutsche Staaten der Nachkriegszeit schlossen die queeren Opfer nahezu
generell von finanziellen Entschädigungen aus. Beide hierarchisierten die verschiedenen Opfergruppen unterschiedlich im Hinblick auf Entschädigungen und
Rentenanerkennungen; u. a. hatten es auch Roma und Sinti besonders schwer. In
der DDR gab es keine Möglichkeit auf Entschädigung, die Betroffenen galten
nicht als „Opfer des Faschismus“. In der Bundesrepublik Deutschland bestand bis
1969 §175 StGB in der Fassung der NS-Zeit – in der DDR fand die Verfolgung
nach §175 StGB „nur“ in der Fassung der Weimarer Zeit statt – und nur theoretisch hatten queere Verfolgte die Möglichkeit auf Entschädigung. Queere Opfer
hätten mit Hilfe des 1957 verabschiedeten Allgemeinen Kriegsfolgegesetzes
eventuell Entschädigung erhalten können, doch da schwule und bisexuelle Männer weiter kriminalisiert wurden, offenbarten sich nur wenige den Behörden.
Zeichen, dass Unrecht geschah
Die queeren Opfer anzuerkennen und bei den Betroffenen um Verzeihung zu bitten, ist über 80 Jahre nach dem Ende des nationalsozialistischen Schreckens ein
symbolischer Akt. Es sind keine noch lebenden Opfer bekannt. Aber für die Hinterbliebenen und Angehörigen wäre dies ein Zeichen der Einsicht des Gesetzgebers, dass hier Unrecht geschah.
Quellen: Bundestag, FOKUS-Sozialrecht
Abbildung: pixabay.com Rainbow-flag-4552833_1280.jpg